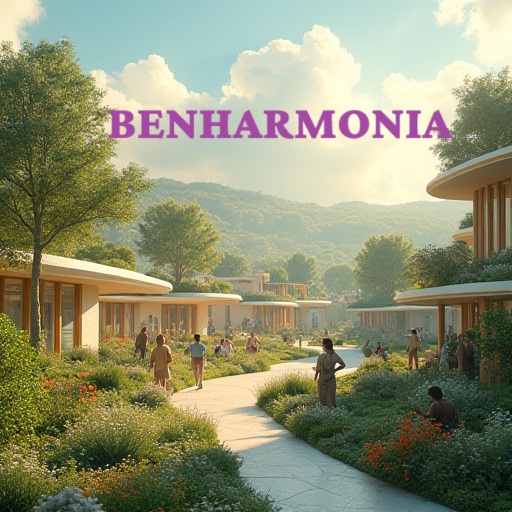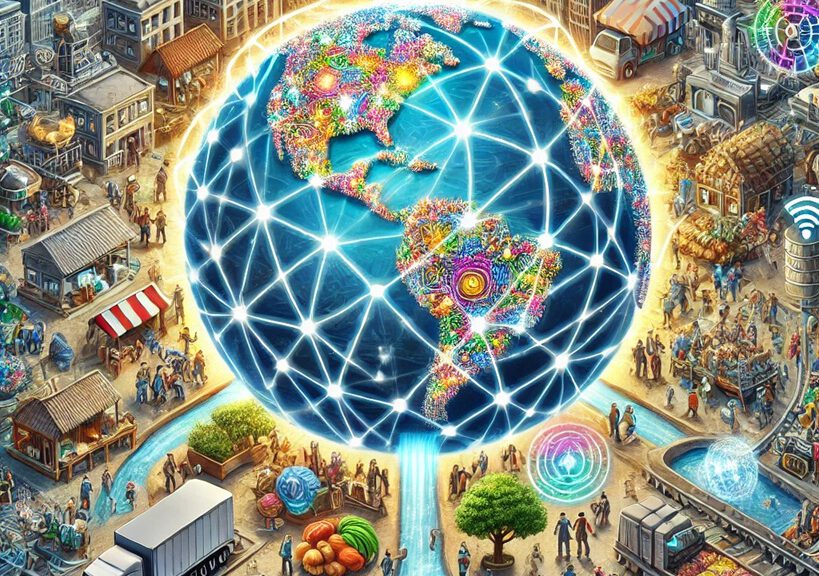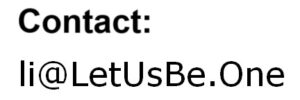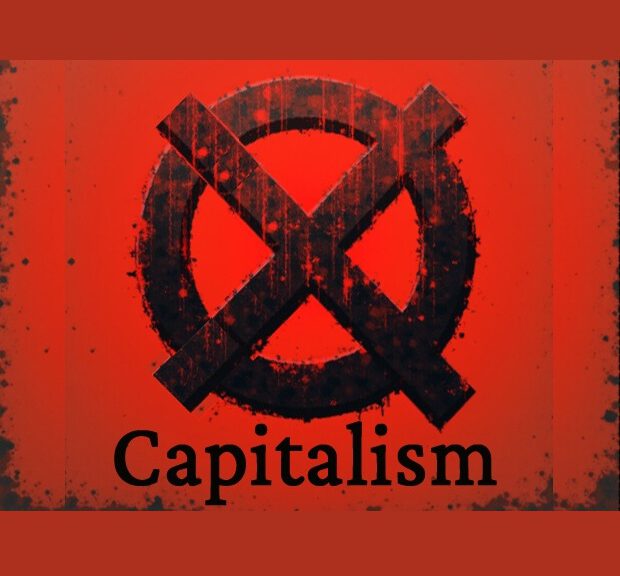Benharmonia – die Revolution des Gebens
Maya und Helena unterhalten sich darüber, wie das heutige Wirtschaftssystem nachhaltig gemacht werden kann.
Sie kommen auf eine ganz überraschende Lösung, die aber letztendlich logisch und durchführbar ist.
Charaktere:
Maya: Eine junge Frau, technikaffin, pragmatisch und idealistisch.
Elena: Eine ältere Frau, erfahrene Aktivistin, mit einem feinen Sinn für Humor.
1. Einleitung: Wir hatten Sushi
* Die Szene spielt auf einer Terrasse mit Blick auf eine lebhafte Stadt. Es ist ein heißer Sommertag, und die Beiden sitzen bei einem Drink zusammen. Man spürt die Spannung in der Luft, die Diskussion steht kurz davor, Fahrt aufzunehmen.*
**Helena** (blickt seufzend auf die Stadt):
„Es fühlt sich an, als würde die Welt aus den Fugen geraten. Alles dreht sich nur noch um Profit, während immer mehr Menschen leiden und die Erde unter den Belastungen ächzt. Wie lange kann das noch so weitergehen?“
**Maya** (schmunzelt):
„Stimmt, aber solange die Börsenkurse steigen, interessiert das doch niemanden, oder? Und wenn die Ozeane leergefischt sind, dann können wir sagen, wie hatten immerhin einmal Sushi.“
** Helena** (lächelt ironisch):
„Du machst Witze, aber genau das ist das Problem. Seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaft vor den Konsequenzen unseres Handelns – doch wir hören einfach nicht hin.“
**Maya** (besorgt):
„Willst du damit sagen, dass wir alle Teil des Problems sind?“
**Helena** (zornig):
„Ja, das ist ja das Tragische! Alle wollen mehr Gehalt, höhere Renten, mehr Wohlstand, obwohl wir längst spüren, dass irgendetwas dabei nicht passt.“
**Maya** (nachdenklich):
„Hmmm. Die Medien berichten vom menschengemachten Klimawandel und von der fortschreitenden Ungleichheit aber gleichzeitig bedauern sie die Stagnation des Wirtschaftswachstums.
So, als ob beides vollkommen unabhängig voneinander ist.“
**Helena** (frustriert):
„Ja, wenn die Wirtschaft weiter wächst, dann wird immer mehr Treibhausgas emittiert. Wir müssen daran denken, dass die Produktion hauptsächlich in Ländern passiert, die sich nicht um das Klima scheren.
Und die steigenden Profite der Unternehmer verschlimmern die Ungleichheit immer mehr.“
**Maya** (aufbrausend):
„Du hast ganz recht. Die Politik geht den Ursachen nicht auf den Grund sondern liefert nur halbherzige Ausreden. Da müssen wir uns überhaupt nicht wundern, wenn sich unsere Gesellschaft immer mehr spaltet.“
**Helena** (belehrend):
„Ja, das Einzige, auf das die Politik Wert legt, ist das stetige Wirtschaftswachstum. Wir haben diesen Irrglauben verinnerlicht, dass ohne Wirtschaftswachstum alles zusammenbrechen würde. Aber das ist schlichtweg falsch.“
**Maya** (verblüfft):
„Du hast recht, alle natürlichen Systeme streben nach einem Gleichgewicht, um überleben zu können. Warum kann eigentlich unsere Wirtschaft nicht dasselbe Ziel verfolgen?“
**Helena** (deutlich):
„Also Maya, ob du willst oder nicht, um das zu verstehen, müssen wir leider ein bisschen tiefer in die wirtschaftlichen Zusammenhänge eintauchen.“
2. Die wirkliche Ursache
der globalen Probleme:
Wirtschaft oder Finanzsystem?
**Maya** (neugierig):
„Was ist es denn nun, das verhindert, dass die Wirtschaft in einen Gleichgewichtszustand kommt?“
**Helena** (nachdenklich):
„Das ist nicht so leicht zu beantworten. In unserer globalen Wirtschaft geht es ja hauptsächlich um Profite und Wettbewerb. Unternehmen, die nicht profitabel sind, gehen unter.“
**Maya** (fragend):
„Warum sind eigentlich Profite so wichtig, dass sie über Gedeih und Verderb eines Unternehmens entscheiden?“
**Helena** (überlegend):
„Nun, Profite brauchst du, um Kredite abzubezahlen und die Banken nutzen die Kredite, um das Geld zu vermehren. Jedes Mal, wenn ein Kredit aufgenommen wird, wird neues Geld geschaffen. Ich denke, das ist der tiefe Sinn des Wachstums.“
**Maya** (ironisch):
„Irgendwoher müssen ja die Milliarden kommen.“
**Helena** (verdeutlichend):
„Genau, das ist das eigentliche Problem. Das Finanzsystem nutzt die Wirtschaft dazu, um Kapital zu vermehren. Obwohl die Wirtschaft rein theoretisch ohne ständiges Wachstum auskommen könnte, setzt der finanzielle Zwang sie unter Druck.“
**Maya** (bestätigend):
„Richtig. Und die Wirtschaft wiederum zwingt die Menschen mit Reklame, Rabattaktionen und geplanter Obsoleszenz dazu, immer mehr zu konsumieren, damit das Wachstum weitergehen kann.“
**Helena** (fragend):
„Weißt du eigentlich, warum es immer mehr Kriege gibt und nichts Wirksames gegen den Klimawandel unternommen wird?“
**Maya** (nachdenklich):
„Etwa wegen des Wachstums?“
**Helena** (erklärend):
„Genau so ist es. Denn auch der Export von Waffen und die Reparatur von Schäden aus Kriegsereignissen und Klimakatastrophen tragen zum Wirtschaftswachstum bei.“
**Maya** (zweifelnd):
„Aber stell dir doch mal vor, wenn das Wachstum abnehmen und die Wirtschaft schrumpfen würde, müssten die Menschen dann nicht auf Wohlstand verzichten?“
**Helena** (erklärend):
„Verzicht ist relativ. Es kommt ganz darauf an, wie Wohlstand definiert wird. Heute definiert die Politik Konsum als Wohlstand, weil Konsum dem Wachstum dient.“
**Maya** (nickt verblüfft):
„Stimmt, wenn dieser Einfluss weg wäre, dann würde es uns nichts ausmachen, wenn die Wirtschaft schrumpft und sich die Erde wieder erholen kann.“
**Helena** (inspiriert):
„Genau, wir wissen seit langem, dass Konsum nicht glücklicher macht sondern Stress in unser Leben bringt. Und wir haben total vergessen, wie wichtig Freizeit ist. Vor allem die Freizeit, die wir mit unseren Kindern verbringen.“
3. Weniger Wirtschaft – mehr Arbeitslose
**Maya** (ernst, lehnt sich zurück):
„Aber denke doch mal nach, wenn weniger gearbeitet wird, dann gibt es doch mehr Arbeitslose. Ist das nicht der Grund, warum die Gewerkschaften für immer mehr Arbeitsplätze kämpfen?“
**Helena** (träumerisch):
„Viele Menschen dachten früher, dass „Im Jahr 2000“ die meiste Arbeit von Robotern übernommen wird und die Menschen immer mehr von Lohnarbeit befreit werden. Selbst namhafte Ökonomen wie John Maynard Keynes waren davon überzeugt.“
**Maya** (hin- und hergerissen):
„Wahrscheinlich gingen sie davon aus, dass sich der gesellschaftliche Reichtum von alleine verteilt. Aber das ist nicht passiert.
Haben wir nicht aufgepasst? Oder haben wir den falschen Menschen vertraut? Aber irgendwie lässt sich das bestimmt wieder hinbiegen denn das was du gesagt hast, klingt ja vollkommen logisch.“
**Helena** (die Stirn in Falten ziehend):
„Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder müssen alle Menschen so viel Geld bekommen, dass sie ein würdevolles Leben führen können – egal ob sie für Lohn arbeiten oder arbeitslos sind …“
**Maya** (aufbrausend):
„Na, damit wäre wahrscheinlich niemand einverstanden, das wäre ja sehr ungerecht!“
**Helena** (fällt ein):
„…oder jeder müsste sich bedingungslos das nehmen können, was für ein Leben in Würde nötig ist.“
**Maya** (zustimmend):
„Richtig, dann gäbe es keine Angst vor Arbeitslosigkeit mehr.“
**Helena** (begeistert):
„Auf diese Weise würde sich der gesellschaftliche Reichtum von ganz alleine verteilen. Wahrscheinlich haben die Vordenker der Utopie wie Marx und Keynes auch an so etwas gedacht, sie wussten bloß nicht, wie die Geldlogik überwunden werden soll.“
**Maya** (überlegt)
„Gibt es nicht in der Bibel schon etwas Ähnliches?“
**Helena** (bestätigt):
„Ja, das Gleichnis Christi von den Arbeitern im Weinberg im neuen Testament. Der Weinbauer bezahlte seine Arbeiter nicht nach der Arbeitszeit sondern er gab ihnen das, was sie für einen Tag benötigten.“
**Maya** (lächelt)
„Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Idee noch besser ist?“
**Helena** (schmunzelt):
„Ja, jeder Mensch könnte sich genau das nehmen, was er für ein zufriedenes Leben benötigt.“
**Maya** (überzeugt)
„Das ist doch noch viel gerechter, als wenn die Menschen pauschal eine Geldsumme bekommen, die Andere für sie festlegen.“
**Helena** (bekümmert)
„Wobei wir wieder beim Finanzsystem sind.“
*Maya** (blickt in die Ferne):
„Die Frage ist deshalb, wie wir dieses Finanzsystem aus der Gleichung nehmen können.“
4. Wie können wir das Finanzsystem von der Wirtschaft abkoppeln?
**Helena** (erläuternd)
„Das Finanzsystem kann überall dort mitmischen, wo Geld im Spiel ist. Wenn du deinen Kindern zu Hause eine Puppenstube bastelst, könnte es dir nicht hineinreden. Profit gibt es dort nicht.“
**Maya** (nachdenkend)
„Du meinst also, dass das Problem darin besteht, dass heute die Arbeit bezahlt wird? Wenn das nicht wäre, dann freilich hätte das Finanzsystem keinen Angriffspunkt in der Wirtschaft.“
**Helena** (präzisierend):
„Eigentlich ist es ganz einfach. Die Waren kosten nur deshalb etwas, weil wir uns unsere Arbeit bezahlen lassen. Heute müssen wir uns unsere Arbeit bezahlen lassen, um Geld zu bekommen, damit wir uns diese Waren wieder kaufen können. Verrückt, nicht?“
**Maya** (nachdenklich):
„Kannst du das noch ein bisschen näher erklären?“
**Helena** (lächelt):
„Okay, stell dir vor, du findest einen Klumpen Lehm und formst daraus eine Schüssel. Wenn du die Schüssel verschenkst, hat sie keinen monetären Wert bekommen. Wenn du die Schüssel verkaufst, dann hat nur deine Arbeit diesen Geldwert erzeugt, denn der Lehm hat in beiden Fällen nichts gekostet“
**Maya** (enthusiastisch):
„Du meinst also, wenn alles durch freiwillige Arbeit geleistet wird, also nicht nur Schüsseln, sondern alle Waren und Dienstleistungen die die Menschen benötigen, könnten wir uns alles, was wir brauchen, einfach gegenseitig schenken?“
**Helena** (zustimmend):
„Genau. Es gäbe dann keinen Angriffspunkt mehr für das Finanzsystem. Es wäre von der realen Wirtschaft losgelöst.“
**Maya** (lacht):
„Du glaubst doch nicht wirklich, dass die Leute einfach so anfangen würden, umsonst zu arbeiten?“
**Helena** (mit spielerischem Ton):
„Warum nicht? Wir alle tun das doch schon in gewisser Weise. Nur einen Teil eines jeden Tages arbeiten wir für Geld und müssen unsere Ellenbogen gebrauchen, weil wir im Wettbewerb mit anderen stehen. Aber was ist, wenn wir nach Hause kommen?“
**Maya** (nickt zustimmend):
„Ja, du hast recht! Sobald wir zu Hause sind, verhalten wir uns ganz anders. Dann sind wir kooperativ und hilfsbereit. Diese Hälfte unseres Tages arbeiten wir ja schon freiwillig – sei es für die Familie, für Freunde oder für die Gemeinschaft.
**Helena** (euphorisch):
„Ein großer Teil der Menschheit arbeitet sogar den ganzen Tag freiwillig. Und oft sind wir dabei viel engagierter, als wir es für Geld wären.“
**Maya** (bestätigend):
„Wir sehen also, unser Verhalten wird von der Umgebung geprägt, wo wir uns gerade befinden. Wir passen uns zweimal jeden Tag an diese Umstände an, gewissermaßen sind wir soziale Chamäleons.“
**Helena** (bestätigend):
„Lass uns nochmal nachdenken. Wenn kein monetärer Wert da wäre, also wenn die Waren nichts kosten würden, dann hätte auch das Finanzsystem keinen Zugriff mehr.“
**Maya** (mit erhobener Augenbraue):
„Das bedeutet natürlich auch, dass alle Waren für alle Menschen frei verfügbar wären und jeder kann sich bedingungslos das nehmen, was er wirklich braucht, um zufrieden und glücklich leben zu können.“
**Maya** (schmunzelt):
„Und was würde dann mit dem Finanzsystem passieren?“
**Helena** (entspannt):
„Eigentlich gar nichts. Es würde sich einfach auflösen. Das Finanzsystem erzeugt keine materiellen Werte, also würde uns nichts fehlen, wenn es weg ist.“
**Maya** (staunt):
„Und was ist mit all den Menschen, die sich heute um die ganzen Geldangelegenheiten kümmern?“
**Helena** (zwinkert):
„Weil alle Waren und Dienstleistungen für alle Menschen gratis verfügbar sind, wären auch sie selbstverständlich versorgt. Sie könnten in den Bereichen helfen, die weiterhin gebraucht werden.“
** Maya ** (zustimmend):
„Also bräuchten wir nur umsonst zu arbeiten und somit wären alle Waren und Leistungen kostenlos.
Dann ist das Finanzsystem raus aus der Wirtschaft!“
**Helena** (schmunzelnd):
„Ja, so einfach ist es. Den produzierten Waren ist es ja vollkommen egal, ob sie durch bezahlte oder durch freiwillige Arbeit hergestellt werden.“
**Maya** (zweifelnd):
„Helena, du hattest gerade das Beispiel mit dem Klumpen Lehm gebracht, den jemand gefunden hat. Meist liegt jedoch der Lehm in einer privaten Lehmgrube, und jemand will Geld damit verdienen.“
**Helena** (zustimmend):
„Da hast du ganz recht. Deshalb sollten wir uns erst einmal ein bisschen über das Eigentum unterhalten.“
5. Was wird aus dem Eigentum?
**Maya** (neugierig):
„Wenn es keinen Profit mehr gibt, was passiert dann eigentlich mit dem Eigentum? Wird alles einfach allen gehören?“
**Helena** (denkt nach):
„Die Vergesellschaftung von Eigentum wurde ja schon einmal ausprobiert, und es hat nicht funktioniert. Was passierte beim Zusammenbruch des Sozialismus nach 1989 mit dem ganzen Volkseigentum? Es wurde wieder privatisiert. Das war ganz einfach, weil auch gesellschaftliches Eigentum letztendlich Eigentum ist.“
**Maya** (nickt):
„Da hast du ganz Recht. Wenn es keinen Anreiz gibt, Profit zu machen, verliert das Eigentum natürlich seine Bedeutung.“
**Helena** (überzeugt):
„Ja. Eigentum wie Wohnungen, Fabriken und Felder braucht man, um Geld damit zu verdienen, also für den Profit. Das ist die hauptsächliche Aufgabe des Eigentums heute.“
**Maya** (staunt):
„Aber was passiert denn nun, wenn es keinen Profit mehr gibt?“
**Helena** (darlegend):
„Betrachte es einmal von einer anderen Seite her. Wenn überall freiwillig gearbeitet wird und wir uns gegenseitig beschenken, bekommen natürlich auch die Wohnungseigentümer, die Fabrikbesitzer und Großbauern alles geschenkt.
Deshalb werden sie den Profit überhaupt nicht vermissen.“
**Maya** (erfreut):
„Deshalb wäre es auch kein Problem, wenn der Klumpen Lehm aus einer privaten Lehmgrube entnommen wird?“
**Helena** (nickt):
„Nein, ich denke, du könntest ihn dann einfach nehmen, wenn du darum bittest.“
**Maya** (zweifelnd):
„Soweit gut. Aber wenn irgendwann die Lehmgrube leer ist und renaturiert werden muss, wer ist dann dafür verantwortlich?“
**Helena** (überlegend):
„Gute Frage. Natürlich ist der Eigentümer der Lehmgrube trotzdem noch dafür verantwortlich.“
**Maya** (lächelnd):
„Ja, obwohl er nichts davon hat. Wahrscheinlich würde er sie am liebsten verkaufen, aber das geht nicht, weil er ja kein Geld mehr dafür bekommen kann. Also ist die Lehmgrube nur noch eine Last, von der er sich am liebsten befreien würde.“
**Helena** (nickt):
„Die einzige Möglichkeit ist also, dass er sie frei gibt, sich ganz von ihr löst.“
**Maya** (mit hochgezogener Augenbraue):
„Also was nun: das Eigentum gehört dann allen gemeinsam?“
**Helena** (hinweisend):
„Nein, ganz im Gegenteil! Das Eigentum gehört dann überhaupt niemandem, so wie es für den Großteil der Menschheitsgeschichte der Fall war.“
**Maya** (erleichtert):
„Das ist ja echt genial. In so einem Falle wäre es wahrscheinlich auch rein rechtlich viel schwieriger, wieder etwas zu privatisieren. Die einfache Rückübertragung in Privateigentum, also das, was 1989 mit dem Volkseigentum passiert ist, wäre dann gar nicht mehr möglich.“
**Helena** (überzeugt):
„Und aus „Besitz“ wird dann einfach Respekt vor der Privatsphäre anderer.“
**Maya** (nickt):
„Und weil alles freiwillig ist, dann kümmern sich alle, die Lehm entnommen haben, freiwillig um die Renaturierung.“
6. Die Revolution des Schenkens
**Helena** (ernst):
„Die Geschichte zeigt, dass große Veränderungen oft durch Krisen ausgelöst werden. Und die Krisen sind schon da. Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit, Kriege um Rohstofflagerstätten.“
**Maya** (nachdenklich):
„Ja, wir müssten jetzt wirklich etwas unternehmen, wenn wir den Kollaps der Menschheit vermeiden wollen. Viele denken an eine Revolution wie 1917 in Russland.“
**Helena** (beschwichtigt):
„Aber die damalige Idee des Kommunismus hat ja nicht funktioniert. In vielen Ländern ist er zusammengebrochen und die letzten beiden großen Staaten, die sich noch kommunistisch nennen, wirtschaften schlimmer als der Rest der Welt. Deswegen zerbrechen wir uns ja den Kopf.“
**Maya** (überzeugt):
„Ich denke, für eine solche Revolution sind die meisten Menschen auch nicht bereit. Es müsste aber trotzdem etwas wie eine Revolution sein denn nur wenn es auf der ganzen Welt gleichzeitig passiert kann es funktionieren.“
**Helena** (motivierend):
„Natürlich. Wegen des internationalen Handels müssen die Waren weltweit kostenlos verfügbar sein. Gibt es nicht noch etwas anderes. Was sagst du zu einem globalen Generalstreik?“
**Maya** (neugierig):
„Ja, einen globalen Generalstreik könnten sich wahrscheinlich die meisten Menschen vorstellen. Streiks sind ja schon fast etwas Alltägliches.“
**Helena** (präzisierend):
„Das Leitmotiv könnte sein, dass gefordert wird, Arbeitslosigkeit und Lohnarbeit gleichzustellen, damit kein Mensch mehr benachteiligt ist.“
**Maya** (zweifelnd):
„Aber wird denn die Wirtschaft nicht zusammenbrechen, wenn alle Menschen streiken?“
**Helena** (dozierend):
„Wer sagt denn, dass die Menschen die Arbeit niederlegen müssen. Sie könnten doch genausogut weiterarbeiten. Sie müssten doch nur auf ihren Lohn verzichten.“
Die Arbeit niederzulegen wäre ja wirklich Blödsinn. Wir wollen doch die Wirtschaft nicht durcheinanderbringen sondern sie einfach nur vom Zwang des Finanzsystems befreien.“
**Maya** (begeistert):
„Genau, das ist es! Dann blieben die Lieferketten intakt, aber die Waren wären frei zugänglich. Ade Finanzsystem und das war‘s.“
**Helena** (nickt zustimmend):
„Ja, das wichtigste ist, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Wir befreien die Wirtschaft nur vom Zwang des Finanzsystems und dann könnte sie sich von ganz alleine nachhaltiger entwickeln.“
**Maya** (bestätigend):
„Warum soll das eigentlich nicht klappen. Ich vermute, die meisten Unternehmer:Innen möchten gerne nachhaltig produzieren, aber der Wettbewerb und der Profitzwang hindern sie daran. Ohne diesen Druck könnten sie ihre Visionen verwirklichen.“
**Helena** (mit einem Lächeln):
„Wenn Arbeit nichts mehr kostet, dann spielt es keine Rolle mehr, wie lange gebraucht wird, um etwas wirklich gut und nachhaltig zu entwickeln und zu produzieren.“
**Maya** (begeistert):
„Deshalb steht auch einer wirklichen Kreislaufwirtschaft, die natürlich viel aufwändiger ist als die heutige Wegwerfwirtschaft, überhaupt nichts mehr im Wege. Wir könnten vollständig recycelbare Produkte herstellen und die Rohstoffknappheit wäre Geschichte.“
**Helena** (fügt hinzu):
„Damit ist auch das Hauptargument der heutigen Politiker:Innen entkräftet. Sie sagen, dass das heutige Finanzsystem unverzichtbar wäre, damit die Rohstoffe umso teurer sind, je knapper sie werden.“
**Maya** (etwas verärgert):
„Was für ein Unsinn! Dadurch wird heute bloß die Ungleichheit immer größer, weil sich nur die reichen Länder die knappen Rohstoffe leisten können. Kriege um Rohstoffe wird es trotzdem geben. Aber das verschweigen sie, weil sie keine bessere Idee haben – im Gegensatz zu uns beiden.“
**Helena** (bestätigend):
„Ja, wenn Arbeit nichts kostet, könnten sich auch die Produktionszyklen wieder verlangsamen. Es würde keine geplante Obsoleszenz mehr geben, keine ständig neuen Modelle, die verkauft werden müssen. Bisher führt das ja zu immer mehr Abfall, Abgasen und Ressourcenverbrauch. Stattdessen könnten wir uns wieder auf langlebige und qualitativ hochwertige Produkte konzentrieren.“
**Maya** (enthusiastisch):
„Die Menschen würden sich bestimmt schnell anpassen. Manche blieben einfach länger zu Hause, andere würden dort helfen, wo Hilfe nötig ist.“
**Helena** (bestätigt):
„Genau. Sicher würde es schnell zu einer Zwei- oder Dreitagewoche kommen, wenn die Leute aus der Finanzbranche alle dazukommen.“
**Maya** (zweifelnd):
„Jetzt noch mal zum freiwillig arbeiten. Das ist ja alles schön und gut, aber die Unternehmer:Innen werden doch nicht freiwillig aufhören, Geld für ihre Waren zu verlangen.
Was passiert, wenn sie nicht mitspielen?“
**Helena** (ruhig):
„Guter Punkt. Aber auch sie werden nach der Umstellung alles kostenlos bekommen, was sie brauchen – auch alle Rohstoffe und Zwischenprodukte. Es gibt keinen Grund mehr für sie, sich die Mühe zu machen, um Geld einzusammeln. Ich glaube, gerade auch die Unternehmerinnen und Unternehmer werden gerne auf die ganze Finanzbuchhaltung verzichten.“
**Maya** (zweifelnd):
„Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die in den Lithium-Gruben schuften, freiwillig weiterarbeiten würden.“
**Helena** (erklärend):
„Das wäre zunächst überhaupt nicht schlimm, weil die Menschen im globalen Süden meist für unseren extensiven Lebensstil ausgebeutet werden. Stonewash-Jeans, Plastikspielzeug, Garnelen schälen. Es schadet uns überhaupt nicht, wenn wir einmal eine Weile auf diesen Luxus verzichten müssten, bis wir bessere Lösungen dafür gefunden haben.“
7. Ende der Entfremdung der Arbeit
**Maya** (entspannt):
„Wenn Arbeit freiwillig ist, könnte sie ihre Bedeutung vollkommen verändern – sie wird Ausdruck von Kreativität und Beitrag zur Gemeinschaft.“
**Helena** (schmunzelt):
„Und wenn niemand mehr aus Zwang arbeiten muss, dann wird auch der Wert der Arbeit ganz anders geschätzt. Die Motivation kommt dann aus der Freude an der Tätigkeit selbst.“
**Maya** (begeistert):
„Ja, wenn ich nicht irgendetwas arbeiten muss, nur um Geld zu verdienen, dann kann ich mir eine Tätigkeit suchen, die mir wirklich Spaß macht und auf die ich mich jeden Abend freue.“
**Helena** (nachdenklich):
„Eigentlich wird dieses Problem auch schon in der Bibel, genauer im neuen Testament behandelt. In einem Gleichnis empfiehlt Christus den Menschen, dass sie ihr Talent mehren und nicht einzwängen sollen.“
**Maya** (mit erhobener Augenbraue):
„Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass uns der Zwang zu bezahlter Arbeit genau vor dieses Problem stellt. Wenn du dagegen freiwillig arbeitest, also ohne Zwang, dann wirst du dein Talent entfalten können.“
**Helena** (fügt hinzu):
„Überleg mal – die Menschen könnten sogar ihren Leidenschaften nachgehen. Diejenigen, die gerne backen, würden auch mal um vier Uhr früh‘s aufstehen, um leckere Brötchen und Croissants zu machen und anzubieten.“
**Maya** (skeptisch):
„Aber was ist mit den unangenehmen Arbeiten? Wer würde die noch machen?“
**Helena** (zuckt mit den Schultern):
„Wir würden sie gemeinsam bewältigen, aus Solidarität, nicht aus ökonomischer Notwendigkeit. Irgendwann ist jeder mal dran. Außerdem könnten viele Aufgaben automatisiert werden.“
**Maya** (nickt, entschlossen):
„Du hast so was von recht. Solange Arbeit bezahlt wird, findest du immer Leute, die billiger sind als Roboter. Stell dir vor, in der Benharmonia könnten viele Autofabriken einfach Roboter produzieren!“
**Helena** (mit ruhiger Stimme):
„Das könnte die Entfremdung von der Arbeit beenden, die die Menschen heute spüren. Die Jobs würden besser zu den persönlichen Talenten und Interessen passen. Arbeit wird wieder erfüllend, weil sie nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern ein Teil des Lebens ist.“
8. Wie werden wir dann leben?
**Maya** (lächelt):
„Also, wenn alles gratis ist, dann werde ich mir jeden Tag ein neues Kleid von Prada holen und jeden Abend in Champagner baden!“
**Helena** (lacht):
„Das bezweifle ich. Menschen verhalten sich in der Regel verantwortungsvoll, wenn sie nicht dazu gezwungen werden, besser zu scheinen als die anderen.“
**Maya** (zustimmend):
„Stimmt. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass wir uns auch heute einen großen Teil jeden Tages absolut kooperativ verhalten, wenn wir nicht unter dem Einfluss des Marktes stehen.“
**Helena** (begeistert):
„Wir würden uns dann den ganzen Tag eher wie im Kreis von Familie oder Freunden fühlen. Schließlich beschenken wir uns dann ja gegenseitig.“
**Maya** (einsichtig):
„Für ein gutes Leben braucht man auch überhaupt keine Milliarden. Die belasten eigentlich nur, weil immer dafür gesorgt werden muss, dass sie sich vermehren.“
**Helena** (entspannt):
„Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Milliardär auch ein ganz normales Familienleben hat. Die großen Ausgaben haben sie ja nur, weil sie repräsentieren müssen um am Ball zu bleiben.“
**Maya** (besorgt):
„Aber dann werden ja auch keine Steuern mehr bezahlt. Wenn niemand mehr Steuern zahlt, wie finanzieren wir dann Verwaltung, Bildung oder Kunst?“
**Helena** (belustigt):
„Also, jetzt denk doch mal nach. Wenn alles kostenlos ist…. Macht es klick?“
**Maya** (sarkastisch):
„Und was ist, wenn jemand einfach nur faul ist? Will ja nicht jeder kreative Projekte verfolgen oder zum Wohle aller beitragen.“
**Helena** (zwinkert):
„Das haben die Leute auch über das bedingungslose Grundeinkommen gesagt. ‚Wenn niemand arbeiten muss, arbeitet keiner mehr‘. Aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen etwas Sinnvolles tun wollen. Es ist ein Mythos, dass die Leute von Natur aus faul sind.“
**Maya** (leicht skeptisch):
„Aber was wird dann aus Fortschritt und Innovation?“
**Helena** (überzeugt):
„Innovation wird nicht durch Wettbewerb angetrieben, sondern durch die Neugier und den Wunsch, die Welt zu verbessern. In der Benharmonia würden Fortschritte in Wissenschaft und Technik auf echte Bedürfnisse abzielen, statt Produkte auf den Markt zu werfen, nur um sie verkaufen zu können.“
9. Epilog
**Helena** (träumerisch):
„Der Wettbewerb hat aber auch etwas positives, er hat uns seit der Epoche der Aufklärung, seit Adam Smith auf den heutigen Stand von Wissenschaft und Technik gebracht.“
**Maya** (etwas empört):
„Aber du weißt auch, dass ein Wirtschaftsprinzip, das den Verbrauch belohnt, nur so lange eine Existenzberechtigung hat, wie die Ressourcen unerschöpflich sind!“
**Helena** (nachdenklich):
„Ja, die letzten 50 Jahre waren für die meisten Menschen hier im globalen Norden eine tolle Party.“
**Maya** (verdeutlichend):
„Und jetzt ist Jede und Jeder moralisch dazu verpflichtet, beim Aufräumen mitzuhelfen.“
**Helena** (mit einem Blick auf die untergehende Sonne):
„Ehrlich gesagt, auch ich habe immer an Revolutionen gezweifelt. Aber dies hier ist ja keine Revolution, in der jemandem etwas weggenommen wird.“
**Maya** (mit dem Glas in ihrer Hand):
„Nein, ganz und gar nicht. Es ist eine Revolution des Gebens. In Zukunft werden wir uns gegenseitig beschenken und dafür braucht es keine Ellenbogen mehr.“
**Helena und Maya** (erheben ihre Gläser):
„Lasst uns beginnen, diese Idee auf der ganzen Welt zu verbreiten.
Auf Benharmonia und die Revolution des Gebens!“
Berlin, den 02.02.2025
Eberhard Licht
Download english: https://letusbe.one/de2/Benharmonia_en.pdf
Download español: https://letusbe.one/de2/Benharmonia_es.pdf
Download deutsch: https://letusbe.one/de2/Benharmonia2.pdf
Website: https://LetUsBe.One
Fragen? 
BITTE TEILEN !!!