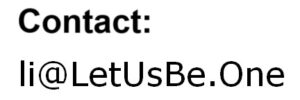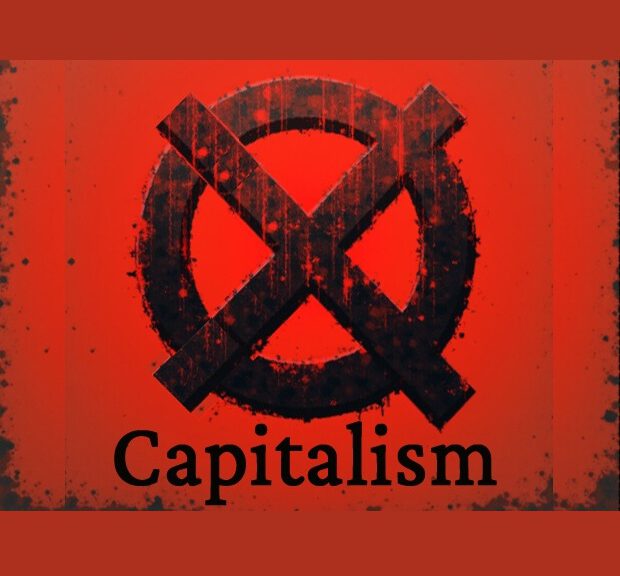pdf-Download: Thesen Programm
1. Die historische Rolle der Arbeiterklasse
Im 21. Jahrhundert und 100 Jahre nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution steht die Arbeiterklasse erneut vor ihrer historischen Aufgabe: sie muss wieder die Massen mobilisieren, um die destruktive Logik des Kapitals zu überwinden.
Doch der Hauptwiderspruch unserer Zeit liegt nicht mehr primär im Verhältnis von Arbeit und industriellem Kapital, sondern er liegt in der Dominanz des globalen Finanzkapitals über die reale Wirtschaft. Eine bloße Vergesellschaftung der Produktionsmittel reicht nicht aus, wie wir am Scheitern des real existierenden Sozialismus feststellen konnten. Ohne die komplette Aufhebung des Tauschwerts und der Profitlogik bleibt die Entfremdung bestehen.
Das globale Finanzsystem diktiert uns nicht nur das Ziel permanenter Kapitalverwertung, sondern auch den Fetisch der Vollbeschäftigung. Obwohl die Produktivkräfte längst ausreichen würden, um die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit massiv zu senken, wird an der Illusion festgehalten, dass nur die flächendeckende Lohnarbeit gesellschaftliche Teilhabe ermögliche.
Damit wird nicht nur die weitere Automatisierung blockiert, sondern auch die Möglichkeit eines unmittelbaren Übergangs in eine klassenlose Gesellschaft systematisch unterdrückt.
Aber es gibt nicht nur Herausforderungen, sondern wir haben nämlich heute auch die Möglichkeit, um den Kapitalismus endgültig zu überwinden. Der Weg zur klassenlosen Gesellschaft ist offen, denn die beiden Hauptkriterien sind erfüllt.
Die Produktivkräfte befinden sich auf einem hohen Entwicklungsstand und das exponentiell steigende globale Wirtschaftswachstum hat ausreichend Überfluss geschaffen.
Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren.
Nur die dialektisch geschulte, vereinigte marxistische Linke hat heute noch das Potenzial, die zerstörerische Spirale von Ungleichheit, Umweltzerstörung, Neokolonialismus und sozialer Desintegration zu durchbrechen. Nur sie ist in der Lage, die historische Weiche zu stellen.
Ohne ein Zukunftsprogramm bleibt die Linke jedoch gespalten – und die Gesellschaft mit ihr.
ErläuterungenRead More
Nur die Arbeiterklasse – geführt von einer vereinigten und dialektisch geschulten marxistischen Linken – hat heute das Potenzial, die zerstörerische Spirale von Ausbeutung, Ungleichheit, Umweltzerstörung und sozialer Desintegration zu durchbrechen.
Die hegelsche Dialektik – das Erkennen innerer Widersprüche als treibende Kraft historischer Entwicklungen – bleibt dabei ein zentraler Vorteil marxistischer Theorie gegenüber technokratischen oder moralisierenden Ansätzen. Nur eine organisierte Linke mit einem strategisch ausgerichteten Zukunftsprogramm kann die arbeitenden Massen mobilisieren.
Der heutige Gegner: Die Macht des Finanzsystems
Die klassische marxistische Analyse richtete sich historisch berechtigt gegen das Privateigentum an Produktionsmitteln und die Ausbeutung des Proletariats durch das industrielle Kapital. Doch im real existierenden Sozialismus wurde deutlich, dass die Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht ausreicht, solange die Arbeit selbst nicht vergesellschaftet ist. Dies hätte eine globale Transformation vorausgesetzt – sie blieb aus.
Die bürgerliche Produktionsweise – vermittelt durch Tauschwert, abstrakte Arbeit und Äquivalententausch – bleibt bestehen, solange Arbeit über Zeit, Produkte über Marktpreise und Bedürfnisse über Verrechnungssysteme organisiert werden. Dieses Versäumnis bereitete den Boden für die Entwicklung des Staatssozialismus mit seinen zentralistischen Herrschaftsstrukturen und seiner anhaltenden Entfremdung.
Heute jedoch hat sich der Kapitalismus strukturell gewandelt: Die Triebkraft der Kapitalakkumulation ist längst nicht mehr primär das industrielle Kapital, sondern das global vernetzte Finanzkapital. Es ist dieses System, das den permanenten Wachstumszwang erzeugt, Innovation in Ausbeutung überführt und jede Entwicklung, die auf den Menschen gerichtet ist, blockiert.
Linke Kämpfe richten sich oft gegen Symptome – Ungleichheit, Armut, Lohnunterschiede –, ohne die eigentliche Machtbasis anzugreifen: das abstrakte Kapital im Finanzsektor, das über Zinsmechanismen, Börsenspekulation und Verschuldung die reale Wirtschaft dirigiert. Solange diese Struktur unberührt bleibt, bleiben alle Reformen rein kosmetisch.
Die Aufgabe heute: Befreiung der Wirtschaft von der Diktatur der Finanzmärkte
Das Ziel kann nicht länger in einer rein institutionellen Vergesellschaftung des Kapitals liegen – etwa in Form staatlicher oder genossenschaftlicher Eigentumsmodelle –, sondern in seiner Entbindung von der Profitlogik. Nicht die „Enteignung der Enteigner“, sondern die Entmachtung des Profits selbst steht heute auf der historischen Agenda.
Erst wenn Produktion nicht mehr auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern auf menschliche Bedürfnisse und ökologische Regeneration, kann die Dialektik des Kapitals aufgehoben und in eine neue, humanistische Produktionsweise überführt werden.
Ein historischer Fehler der Oktoberrevolution bestand darin, das Kapital zu vergesellschaften, ohne die Logik der Kapitalverwertung zu überwinden. Die Folge war die Reproduktion autoritärer Strukturen unter dem Banner des Sozialismus.
Die objektiven Bedingungen für eine klassenlose Gesellschaft – automatisierte Produktion, Überfluss an Ressourcen – waren damals nicht gegeben, und eine weltweite Umwälzung war nicht durchsetzbar.
Aber heute stehen wir an einer historischen Schwelle. Die Möglichkeit zur endgültigen Überwindung des Kapitalismus ist real. Die Produktivkräfte haben ein nie dagewesenes Niveau erreicht, das exponentiell steigende globale Wirtschaftswachstum hat bereits materiellen Überfluss geschaffen, wir sind weltweit vernetzt und die künstliche Intelligenz kann den Markt ersetzen.
Es wäre fatal, diese historische Chance zu verpassen – wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.
Gefahr der Unterwanderung und instrumentellen Spaltung
Linke Bewegungen werden systematisch unterwandert – durch reformistische, technokratische und bürgerlich-institutionalisierte Kräfte. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel der Klimabewegung: Was als globales Aufbegehren begann, wurde durch „wissenschaftliche Beratung“ zu einem entpolitisierten Technikdiskurs umgelenkt. Der Kapitalismus selbst wurde nicht mehr infrage gestellt.
Auch radikalere Gruppen wie Extinction Rebellion wurden durch taktische Zuspitzung innerer Widersprüche – etwa im Bereich Ressourcennutzung – marginalisiert oder ins Lächerliche gezogen. Diese Strategie dient der Spaltung – sowohl innerhalb der Linken als auch der gesamten Gesellschaft.
Die Notwendigkeit eines neuen, vereinigenden Programms
Die heutigen Produktivkräfte – hochautomatisiert, digital vernetzt, global organisiert – ermöglichten erstmals in der Geschichte eine Welt jenseits materieller Knappheit. Doch sie bleiben durch die Logik des Finanzkapitals blockiert. Die Angst vor Jobverlust führt zu einer paradoxen Verteidigung der Lohnarbeit, obwohl die Technisierung sie längst überflüssig gemacht hat.
Was fehlt, ist ein strategisch geschärftes, vereinendes Programm der Linken, das sich nicht in Symptombehandlung verliert, sondern den zentralen Widerspruch zwischen produktiven Möglichkeiten und profitgetriebener Produktionsweise ins Zentrum rückt.
Ein solches Programm darf utopisch sein – nicht im Sinne von illusionär, sondern im Sinne einer radikal realistischen Perspektive auf Befreiung. Auch die Herrschenden nutzen Utopien: Elon Musks Marsvisionen etwa legitimieren politische Interessen. Warum sollten wir es nicht mit einer Utopie der Erd-Befreiung aufnehmen?
Dialektik heißt: den Hauptwiderspruch erkennen
Dialektisches Denken verlangt, die historisch wirksamsten Widersprüche zu identifizieren. Heute liegt der Hauptwiderspruch nicht mehr primär zwischen Arbeit und Kapital, sondern zwischen realer Wirtschaft und einem entfesselten Finanzsystem, das Profite extrahiert und akkumuliert, ohne produktiv zu sein. Wenn die marxistische Linke diesen Widerspruch als zentralen erkennt und die Befreiung der Ökonomie von der Finanzherrschaft ins Zentrum ihrer Strategie stellt, kann sie ihrer historischen Rolle gerecht werden.
Wenn der Profitzwang aufgehoben wird, endet auch die systematische Ausbeutung. Die Menschen werden von Fremdbestimmung befreit.
Was hier skizziert wird, ist kein revolutionärer Umsturz im klassischen Sinn, sondern ein kollektiver Entzug der Arbeitskraft – eine Transformation, die auf friedlichem Weg möglich ist.
2. Die heutige Bedrohung der Menschheit
Die größten globalen Probleme – Umweltzerstörung, Ausbeutung, Ungleichheit, Neokolonialismus und Kriege – sind kein Zufall, sondern direkte Folge des vom Finanzsystem erzwungenen Wirtschaftswachstums.
Nicht die Wirtschaft an sich ist das Problem, sondern die Herrschaft des internationalen Finanzkapitals, das Profite extrahiert und Investitionen lenkt. Die Wirtschaft ist nicht hauptsächlich für die Menschen da, sondern ihre Aufgabe ist die Kapitalakkumulation.
Gerade beginnt eine unvorstellbare Rüstungswelle, die zunächst für Wirtschaftswachstum sorgt. Diese Waffen werden später eingesetzt werden müssen, um mit dem Wiederaufbau der Zerstörungen weiteres Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Wir kennen das vom „Wirtschaftswunder“ nach dem 2. Weltkrieg.
Die Sozialleistungen sind an das Wirtschaftswachstum gekettet. Deshalb sind die Beschäftigten gezwungen, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.
Wenn es gelingt, die Wirtschaft von der Herrschaft des Finanzsystems zu befreien und eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Produktion zu etablieren, kann der destruktive Wachstumszwang beendet werden.
Jetzt ist entschlossenes Handeln nötig.
ErläuterungenRead More
Die ökologische Zerstörung, die steigende Ungleichheit und die neokolonialen Strukturen im Welthandel sind keine zufälligen Fehlentwicklungen. Sie sind direkte und systemische Folgen der Kapitalverwertung unter dem Diktat des Finanzsystems. Der Zwang zur permanenten Kapitalakkumulation – vermittelt über Schulden, Renditeerwartungen und Zinsmechanismen – zwingt die globale Wirtschaft in ein destruktives Wachstumsmodell.
Imperialistische Konkurrenz als Motor von Konflikten
Die globale Konkurrenz um Ressourcen, Absatzmärkte und billige Produktionsbedingungen verschärft die Konflikte zwischen Nationalstaaten, Klassen und Kulturen. Kriege, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Erpressung sind Ausdruck eines Systems, das in seiner Grundlogik auf Konkurrenz und Expansion beruht – und somit ständig neue Spannungsfelder schafft.
Die ökologische Krise als Folge der Kapitalverwertung
Die Erwärmung der Erdatmosphäre ist keine autonome Naturerscheinung, sondern ein Resultat jahrzehntelanger kapitalistischer Produktionsweise. In den 200 Jahren der industriellen Revolution wurden in historisch extrem kurzer Zeit gigantische Mengen der fossilen Energiequellen verbrannt, die in einem Zeitraum von 60 Millionen Jahren entstanden sind.
Dieser rapide Verbrauch hat eine Art geologische ‚Explosion‘ ausgelöst, deren beginnende Auswirkungen wir jetzt spüren, egal wie man es nennt.
Die Rolle des Finanzkapitals in der Reproduktion der Krise
Die zunehmende Macht des globalen Finanzkapitals ist keine bloße Begleiterscheinung, sondern ein Ausdruck der strukturellen Transformation des Kapitalismus selbst. Finanzmärkte diktieren Investitionsentscheidungen, bestimmen Politik und gestalten Gesetzgebung im Sinne kapitalistischer Verwertungslogik.
Dabei wird selbst die ökologische Katastrophe zur neuen Akkumulationsquelle umfunktioniert, indem durch den Wiederaufbau von Zerstörungen Wirtschaftswachstum generiert wird (Die Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 werden auf über 40 Mrd. Euro geschätzt, die zum Bruttoinlandsprodukt beitrugen).
Zur linken Debatte über den Klimawandel
Die berechtigte Skepsis innerhalb linker und marxistischer Kreise richtet sich nicht gegen den Kampf gegen den Klimawandel als solchen, sondern gegen die bürgerliche Vereinnahmung der Klimapolitik. Unter dem Deckmantel ökologischer Verantwortung werden Maßnahmen durchgesetzt, die vor allem die Arbeiterklasse und den globalen Süden belasten, während die Kapitalelite ihre Profite sichert.
Gleichzeitig dürfen wir die Realität der ökologischen Krise nicht relativieren – sie ist eine konkrete, materielle Bedrohung, die aus der Logik kapitalistischer Produktion hervorgeht und die unsere Lebensgrundlagen zerstört.
Die globale Wirtschaftsleistung hat sich seit 1970 verfünffacht, obwohl sich die Weltbevölkerung nur etwa verdoppelt hat. Und das exponentielle Wachstum geht nach Angaben des IMF weiter, obwohl wir bereits deutlich die Auswirkungen anhand zunehmender Naturkatastrophen spüren, die auf die Erwärmung der Erdatmosphäre durch den noch immer zunehmenden Ausstoß von Treibhausgasen zurückzuführen sind.
Abkoppelung der Produktion vom Profit
Nicht „die Wirtschaft“ an sich ist das Problem, sondern ihre Profitabhängigkeit unter den Bedingungen der Kapitalverwertung. Wenn es gelingt, die Wirtschaft von der Herrschaft des Finanzsystems zu befreien und eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Produktion zu etablieren, kann der destruktive Wachstumszwang beendet werden.
Ein solches System, das sich nicht mehr an Profit, sondern am Gemeinwohl und an ökologischer Nachhaltigkeit orientiert, würde es erlauben, die Produktion global zurückzufahren – ohne soziale Verluste, aber mit ökologischen Gewinnen. Die Ungleichheit zwischen globalem Norden und Süden und der Neokolonialismus würden beendet werden können.
3. Der Kapitalismus untergräbt unsere Moralvorstellungen
Verurteilte Kriminelle werden demokratisch zu Präsidenten, rechtsextreme Parteien demokratisch in Parlamente gewählt, Waffenlieferungen an verbrecherische Regimes gelten als wirtschaftlich sinnvoll. Auch Umweltzerstörung und Ausbeutung erscheinen legitim, solange sie profitabel sind.
Wir hören zwar täglich von den Auswirkungen des fortlaufenden Wirtschaftswachstums aber nehmen sie nicht mehr als Gefahr wahr.
Dafür sorgen auch die Medien, die die wirklichen Ursachen geschickt verschleiern.
Demokratie und Ethik werden im Interesse des Kapitals entkernt – der Mensch gewöhnt sich an das Unrecht, um im System zu überleben. Das gefährdet nicht nur die Moral, sondern auch das Leben selbst.
Deshalb fällt es uns immer schwerer, gut und böse zu unterscheiden, wir sind bereits willfährige Diener des Systems. Das führt dazu, dass die Demokratie heute für falsche Ziele missbraucht wird.
Das alles bedeutet, dass wir schnell handeln müssen.
ErläuterungenRead More
In der Spätphase des Kapitalismus erleben wir eine tiefgreifende Erosion kollektiver Moralvorstellungen. Die gesellschaftliche Akzeptanz moralisch verwerflicher Tatsachen wächst – nicht, weil der Mensch von Natur aus gleichgültig ist, sondern weil die kapitalistische Realität ihn dazu zwingt, Unrecht zu normalisieren, um weiter funktionieren zu können.
So wird beispielsweise hingenommen, dass ein verurteilter Straftäter erneut zum Präsidenten der größten Volkswirtschaft der Welt gewählt wird – ein Ausdruck dafür, dass politische Macht nicht mehr an ethische Maßstäbe gebunden ist, sondern durch Medienmacht, Geld und Klasseninteressen definiert wird.
Ebenso ist es zur Normalität geworden, dass demokratisch geführte Staaten mit autoritären Regimen Waffenhandel betreiben. Der Kapitalexport in Form von Rüstungsgütern wird zur legitimen „Wirtschaftsförderung“ erklärt, obwohl er Tod und Elend exportiert.
Auch im Inland zeigt sich die Verrohung der Moral durch kapitalistische Sachzwänge: Massenentlassungen werden als „notwendige Restrukturierungen“ verniedlicht, Obdachlosigkeit als individuelles Versagen dargestellt und die Zerstörung von Lebensräumen im Globalen Süden für den Rohstoffbedarf „grüner Technologien“ wird unter dem Etikett der Nachhaltigkeit legitimiert.
Solche Entwicklungen führen dazu, dass Demokratie zur Fassade verkommt, die zunehmend als Mittel zur Durchsetzung partikularer Interessen dient – abgesichert durch ein Medien- und Finanzsystem, das die öffentliche Meinung nach Verwertungsinteressen formt.
Am Ende dieser Entwicklung steht die Akzeptanz der zunehmenden Ungleichheit, des zunehmenden Neokolonialismus und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Wenn moralische Kategorien wie Gerechtigkeit, Solidarität oder Menschenwürde durch ökonomische Effizienzkriterien ersetzt werden, ist es kein Wunder, dass ökologische und soziale Verwüstung als Kollateralschäden „alternativloser“ Politik gelten.
Es setzt sich bis in unseren Alltag fort. Wenn wir am Bahnsteig stehen und überraschend feststellen müssen, dass unser Zug ersatzlos gestrichen wurde, regen wir uns nicht mehr auf sondern dulden es widerspruchslos.
Wir sind bereits willenlose und willfährige Werkzeuge des Systems geworden. Deshalb kann die Demokratie heute für falsche Ziele missbraucht werden. Darin besteht die große Gefahr aber wir können nichts dagegen tun, es sei denn, wir ändern das System, das zu diesen Verhältnissen führt.
Wir müssen schnell handeln.
Die neue Möglichkeit, den Kapitalismus zu überwinden
4. Direkter Übergang zur klassenlosen Gesellschaft
Die Voraussetzungen für den direkten Übergang vom Kapitalismus zur klassenlosen Gesellschaft sind heute vorhanden.
– Die Produktivkräfte sind entwickelt.
Die Produktivkräfte sind so weit entwickelt, dass eine weitgehende Automatisierung der Wirtschaft möglich wäre. Doch der Kapitalismus blockiert diesen Fortschritt, weil er auf Lohnarbeit und Konsum angewiesen ist.
Die Reserve ergibt sich dadurch, dass ganze Autofabriken problemlos auf die Produktion von Robotern umgerüstet werden könnten.
– Wir leben heute im Überfluss
Wir produzieren heute viel mehr, als wir brauchen. Obwohl sich die Weltbevölkerung seit 1970 nur etwa verdoppelt hat, ist das globale Bruttoinlandsprodukt um das Fünffache gestiegen. Das ist nur möglich, weil wir die Produkte bereits nach durchschnittlich der halben Nutzungsdauer wegwerfen, um etwas Neues zu kaufen.
Die Reserve ergibt sich dadurch, dass wir die Waren problemlos länger in Gebrauch lassen können. Eine weitere Reserve liegt im Zugang der Beschäftigten aus Bereichen, die nach dem Übergang in die klassenlose Gesellschaft wegfallen und die die Wirtschaft unterstützen können.
ErläuterungenRead More
Die beiden zentralen Voraussetzungen für den unmittelbaren Übergang vom Kapitalismus in eine klassenlose Gesellschaft sind heute erfüllt:
Die Produktivkräfte sind weit genug entwickelt.
Die Menschheit verfügt heute über Technologien, mit denen sich große Teile der Wirtschaft automatisieren ließen – von der Landwirtschaft bis zur industriellen Fertigung und Logistik. Doch im Kapitalismus wird diese Automatisierung bewusst gebremst oder in irrationale Bahnen gelenkt.
Wenn nämlich Maschinen menschliche Arbeit ersetzen, verlieren Millionen ihre Einkommen und damit die Möglichkeit, am Konsum teilzunehmen. Das Kapital fürchtet nicht die technische Machbarkeit, sondern den sozialen Kontrollverlust. Deshalb werden weiterhin Menschen beschäftigt, obwohl Roboter einspringen könnten – nicht, weil es sinnvoll wäre, sondern weil das System auf Lohnarbeit und Konsum angewiesen ist.
So entstehen paradoxe Situationen: Statt nützlicher Automatisierung wird Überproduktion betrieben – mit Waren, die niemand wirklich braucht, die absichtlich so konstruiert werden, dass sie weit vor ihrer eigentlichen Gebrauchsdauer kaputt gehen, oder mit psychologischer Manipulation durch Werbung und Rabattaktionen, die uns zum Kauf unnötiger Produkte verführen.
Der wissenschaftlich-technische Stand der Menschheit ist jedoch so hoch, dass es möglich wäre, die Wirtschaft hochgradig zu automatisieren und auch eintönige, gefährliche oder schwere Arbeiten zu ersetzen – etwa durch die Umrüstung ganzer Autofabriken zur Produktion von Robotern.
In der gegenwärtigen kapitalistischen Produktionsweise wird ein erheblicher Teil der Gebrauchswerte weit vor dem Erreichen ihrer natürlichen Verschleißgrenze entsorgt, um den Warenabsatz künstlich zu steigern und das kapitalistische Akkumulationsregime aufrechtzuerhalten. Diese planmäßige Obsoleszenz dient einzig der Aufrechterhaltung des Profits und ist Ausdruck der inneren Widersprüche des Kapitals, das seine Existenz nur durch beständigen Wachstumszwang sichern kann.
Objektiv betrachtet wäre die materielle Grundlage für eine drastische Verkürzung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit – etwa auf eine 20-Stunden-Woche – längst gegeben. Doch anstatt die Produktivkräfte im Interesse der arbeitenden Klasse freizusetzen, unterwirft sich die Gesellschaft weiterhin dem Diktat des Finanzkapitals. Die Ideologie der „Vollbeschäftigung“ wird als Fetisch aufrechterhalten, obwohl sie realiter einer Sabotage der Automatisierung gleichkommt und das Potenzial zur massenhaften Befreiung von entfremdeter Arbeit blockiert.
Ein revolutionärer Bruch mit dem Finanzsystem und der kapitalistischen Warenproduktion würde nicht nur die Basis für die Aufhebung der Lohnarbeit schaffen, sondern auch den Übergang zur klassenlosen Gesellschaft eröffnen. In einer solchen Gesellschaft könnten die Produktivkräfte unter kollektiver Kontrolle und gemäß den Bedürfnissen aller entwickelt werden, wodurch der gesellschaftlich erzeugte Reichtum gerecht verteilt und der Zwang zur Erwerbsarbeit überwunden würde.
Wir leben im Überfluss.
Damit das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrzehnten weiter steigen konnte, wurde die Lebensdauer von Waren systematisch verkürzt. Die sogenannte „geplante Obsoleszenz“ ist zur Norm geworden. Produkte werden entsorgt, lange bevor sie technisch unbrauchbar wären – nicht, weil es notwendig ist, sondern weil der Kapitalismus stetigen Warenumsatz verlangt. Der Zyklus von Kaufen–Verbrauchen–Wegwerfen ist zur Grundbedingung des Profits geworden.
Obwohl sich die Weltbevölkerung seit 1970 nur etwa verdoppelt hat, ist das globale Bruttoinlandsprodukt um das Fünffache gestiegen. Das zeigt: Wir produzieren heute mehr als das Doppelte dessen, was wir tatsächlich brauchen würden – und dennoch scheint es, als herrsche überall Mangel.
Der wahre Überfluss beginnt dort, wo wir uns vom Zwang zur Kapitalverwertung befreien. Wenn Produkte ihre volle Lebensdauer entfalten dürfen und der Zweck der Produktion nicht mehr der Profit, sondern das Gemeinwohl ist, wird sichtbar: Wir haben längst genug für alle im Überfluss.
Da beim Übergang in die klassenlose Gesellschaft das Finanzsystem obsolet wird, stehen auch viele ehemalige Beschäftigte aus dem Finanzsektor, Versicherungen, Marketing und Verwaltung zur Verfügung, die die Wirtschaft nach ihren Fähigkeiten neu und solidarisch unterstützen können.
5. Aufhebung des Kapitalverhältnisses durch Eliminierung des Tauschwertes
Alle Rohstoffe sind ursprünglich kostenlos, denn wir müssen der Erde nichts für sie bezahlen. Die Erde schenkt uns Wasser, Luft, Pflanzen und Rohstoffe. Dafür zahlen wir nichts – es sei denn, jemand hat sich dieses Geschenk angeeignet, um es zu verkaufen. Und genau hier beginnt das Problem.
Die erste Hürde: Eigentum
Die meisten Rohstoffe liegen auf privatem Grund. Nicht weil das natürlich wäre, sondern weil unser System vorsieht, dass Menschen Grund besitzen müssen, um sich darüber Einkommen zu sichern.
Doch was, wenn niemand mehr Geld braucht, weil alles, was er oder sie zum Leben braucht, frei verfügbar ist? Dann würde auch der Grundbesitz seine ökonomische Funktion verlieren. Rohstoffe könnten wieder kostenlos verfügbar sein.
Die zweite Hürde: Lohnarbeit
Auch unsere Arbeit verkaufen wir – weil wir sonst nicht überleben könnten. Das bedeutet aber auch: Solange Arbeit einen Preis hat, müssen die Unternehmer:Innen für ihre Produkte ebenfalls Geld verlangen.
Was aber, wenn wir aufhörten, unsere Arbeit zu verkaufen – und stattdessen freiwillig tätig wären, so wie es in der Zivilgesellschaft und im Care-Bereich Gang und Gäbe ist? Dann könnten die Produkte, Halbzeuge oder Ersatzteile frei abgegeben werden. Es bliebe nur der Gebrauchswert – ohne jeglichen Preis. Dadurch wären die Waren für alle Menschen kostenlos erhältlich und es müsste eigentlich keine Löhne geben.
Durch den kostenlosen Charakter der Waren ist es nicht mehr möglich, Profit abzuschöpfen. Da der Profit verschwindet, hat in einer solchen Wirtschaft das Finanzsystem keinen Zugriff mehr. Es ist somit entmachtet und löst sich auf. Mit dem Verschwinden des Profites wird das Kapital wertlos aber der Gebrauchswert bleibt.
Damit das alles funktioniert, müsste es natürlich weltweit gleichzeitig passieren. Damit alle Grundstücksbesitzer ihren Lebensunterhalt kostenlos bekommen und damit alle Unternehmer:Innen keine Ausgaben mehr für Löhne haben.
Hierfür müsste es weder Gesetze geben, noch müsste etwas an der Wirtschaft verändert werden. Wir müssten bloß von einem Tag auf den anderen damit beginnen, auf unsere Löhne zu verzichten.
Die Wirtschaft muss nicht mehr aufpassen, dass es sich rechnet, sondern sie könnte sich voll und ganz darauf konzentrieren, was die Menschen benötigen um glücklich zu sein. Freizeit macht natürlich auch glücklich.
Da niemand mehr mit der Produktion von Waffen Geld verdienen kann, wird es keine Schaffung von Feindbildern, keine Aufrüstung und letztendlich auch keine Kriege mehr geben.
Mit einem weltweiten gleichzeitigen Übergang zu freiwilliger Arbeit besteht heute die Möglichkeit, mit einem Male die klassenlose Gesellschaft zu verwirklichen – nicht als Utopie, sondern als logische Konsequenz der marxistischen Werttheorie.
ErläuterungenRead More
Arbeit als Quelle des finanziellen Werts
Im Kapitalismus erhält eine Ware ihren finanziellen Wert nicht durch ihren Nutzen, sondern durch die Arbeit, die in ihrer Herstellung steckt. Der Wert der menschlichen Arbeit wird auf die Ware übertragen.
Nach der marxistischen Werttheorie verkauft der Kapitalist die so entstandene Ware nicht nur zum Gegenwert der eingesetzten Arbeitszeit, sondern zu einem höheren Preis – um sich den Mehrwert anzueignen. Dieser entsteht dadurch, dass Arbeiter*innen länger arbeiten, als es zur Reproduktion ihrer eigenen Arbeitskraft nötig wäre.
Dieser Mehrwert ist der Ursprung des Profits. Er ist das Resultat der Ausbeutung der Lohnarbeit und bildet die ökonomische Grundlage des Kapitalverhältnisses. Das gesamte Finanzsystem stützt sich auf diese ausbeuterische Dynamik: Es lebt davon, Mehrwert aus der Realwirtschaft abzusaugen, in Kapital zu verwandeln und zu akkumulieren.
Heute haben wir mit dem Übergang zur klassenlosen Gesellschaft die Möglichkeit, dass die Ware gar nicht erst einen Tauschwert bekommt. Wir können verhindern, dass die Ware einen finanziellen Wert bekommt, indem wir mit Hilfe freiwilliger Arbeit gar keinen „Wert“ auf die Ware übertragen.
Rohstoffe sind Gemeingüter, keine Waren
Der Kapitalismus verschleiert, dass die Rohstoffe, auf denen jede Produktion basiert, Geschenke der Natur sind. Die Erde verlangt keinen Preis für ihre Ressourcen. Sie stellt uns Wasser, Holz, Metalle und Energiequellen kostenlos zur Verfügung. Doch im Kapitalismus werden diese Geschenke in Privateigentum verwandelt, verknappt, mit Lohnarbeit kombiniert und in Warenform auf den Markt geworfen.
Freiwillige Arbeit und die Entstehung tauschwertfreier Produkte
Würde nun die gesamte gesellschaftliche Produktion auf freiwilliger, unentlohnter Arbeit beruhen, änderte sich die Wertstruktur radikal:
- Es würde kein finanzieller Wert mehr entstehen, weil keine Lohnarbeit mehr in die Produkte einginge.
- Der Rohstoff bliebe kostenlos, und durch die freiwillige Arbeit würde kein Tauschwert hinzugefügt.
- Das Produkt hätte weiterhin Gebrauchswert, aber keinen Preis.
Damit wäre die Ware im marxistischen Sinne entwertet: Sie bliebe ein nützliches Gut, aber verlöre ihren Charakter als Ware.
Aufhebung von Geld, Profit und Kapital
In einer solchen Produktionsweise ist kein Lohn mehr nötig, weil Menschen sich gegenseitig mit ihrer Arbeit und den erzeugten Produkten beschenken. Niemand muss etwas kaufen – weil alles kostenfrei zugänglich ist. In der Folge:
- Kein Geld
- Kein Profit
- Keine Akkumulation
- Kein Finanzkapital
Das Finanzsystem verliert den Zugriff auf die Realwirtschaft, weil der Tauschwert nicht mehr existiert und damit kein Profit entstehen kann. Damit wäre die Grundlage für Kapitalverwertung aufgehoben, ohne Zwang, ohne Gewalt, allein durch bewusste kollektive Praxis.
Übergang in die klassenlose Gesellschaft
Dies wäre der reale Übergang in eine klassenlose Gesellschaft im Sinne des historischen Materialismus – nicht durch Enteignung von oben, sondern durch die bewusste Entscheidung der Arbeitenden, ihre Arbeit zu verschenken statt zu verkaufen.
Es gäbe keine Verlierer: Auch die ehemaligen Kapitalisten hätten Zugang zu allen Gütern, die für ein Leben in Würde notwendig sind – aber nicht mehr auf Kosten anderer. Die Klassenverhältnisse würden friedlich aufgehoben, weil ihre materielle Grundlage verschwindet.
Durch die Aufhebung des Profits ändert sich auch die Eigenschaft der Produktionsmittel als Eigentum. Deshalb wird sich das Privateigentum an Produktionsmitteln von alleine auflösen.
6. Der externe Bruch: Warum der Kapitalismus nicht von innen überwunden werden kann
Alle Versuche, das kapitalistische System von innen heraus zu verändern, sind gescheitert, weil es jede Reform an seiner Verwertungslogik misst. Nur eine Maßnahme, die von außen kommt, kann es überlisten: Wenn die arbeitenden Menschen weltweit gleichzeitig aufhören, gegen Lohn zu arbeiten, entzieht das dem Kapital die Grundlage.
Der Internationale Währungsfond IWF prognostiziert für die nächsten fünf Jahre ein weiteres Wirtschaftswachstum von 25 Prozent. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, denn alle Menschen, die ihr Geld angelegt haben, alle Rentner, die auf die nächste Rentenerhöhung warten, brauchen dieses Wachstum, damit ausreichend Rendite entsteht.
Wenn es Initiativen gibt, die versuchen, Nachhaltigkeit durchzusetzen, dann muss das Finanzsystem andere Wege suchen. Es wird beispielsweise ein neues Feindbild geschaffen, damit die Wege für Aufrüstung geebnet werden, die jetzt für das erforderliche Wirtschaftswachstum sorgt.
ErläuterungenRead More
Die Geschichte kapitalistischer Gesellschaften ist zugleich die Geschichte des Scheiterns aller tiefgreifenden Reformversuche innerhalb des Systems. Seit über 50 Jahren versuchen Bewegungen verstärkt, durch staatliche Regulierung, Umverteilung, Mitbestimmung oder ökologische Maßnahmen die destruktiven Folgen der Kapitalakkumulation zu zähmen. Doch jeder ernsthafte Eingriff, der die Profitrate gefährdet, wird neutralisiert, vereinnahmt oder zerschlagen.
Das liegt nicht am Mangel an Ideen oder fehlendem politischen Willen, sondern an der strukturellen Logik des Kapitals selbst. Kapitalismus ist kein offenes System, das beliebig reformierbar ist, sondern eine in sich geschlossene Verwertungsmaschinerie, die jede soziale Maßnahme danach beurteilt, ob sie die Kapitalakkumulation stört oder fördert.
Sobald Reformen an die Substanz dieser Verwertung rühren – etwa durch Verstaatlichungen, progressive Besteuerung oder Eigentumsbegrenzung –, schlägt das System zurück: mit Kapitalflucht, Marktfluktuation, politischer Destabilisierung oder der Integration und Entschärfung oppositioneller Bewegungen.
Selbst sozialdemokratische Parteien, die einst mit dem Ziel antraten, die Wirtschaft „menschlicher“ zu gestalten, wurden in den staatsmonopolistischen Kapitalismus integriert und zu Verwaltern seiner Zwänge umfunktioniert. Auch grüne Bewegungen sind inzwischen Teil des marktkonformen Managements geworden – ihre ökologische Kritik endet meist bei „grünem Wachstum“ und marktbasierten Lösungen. Leider wenden sich auch immer mehr Staaten dem Neoliberalismus zu.
Das System kann nicht von innen heraus revolutioniert werden, weil seine innere Logik jede Maßnahme an der Kapitalverwertbarkeit misst.
Nur ein Bruch von außen kann diese Dynamik unterbrechen – ein Eingriff, der außerhalb der Tauschlogik und unabhängig vom Finanzsystem erfolgt. Die historisch einmalige Möglichkeit dazu besteht heute: durch die kollektive, Entscheidung der arbeitenden Menschen weltweit gleichzeitig nicht mehr für Lohn zu arbeiten, sondern freiwillig – für das Gemeinwohl.
Wenn niemand mehr Löhne fordert, verlieren Geld, Preise und Märkte ihre Grundlage.
Wenn Rohstoffe, Arbeit und Waren nicht mehr gekauft werden müssen, sondern gemeinsam bereitgestellt werden, endet die Notwendigkeit eines Marktes als Vermittler.
Das Besondere dabei ist: Die Produktion muss nicht unterbrochen werden. Im Gegenteil – sie wird lediglich befreit von ihrer destruktiven Ausrichtung auf Profit.
Damit kann die nachhaltige Transformation der Wirtschaft einsetzen. Die Dinge, die wirklich gebraucht werden, werden weiterhin produziert – nur ohne Lohnabhängigkeit, ohne Konkurrenz, ohne Geld.
Ein solcher Schritt ist keine Utopie, sondern eine realistische Strategie im Angesicht der globalen Krise. Er ist der einzig denkbare Weg, das System zu überlisten, nicht frontal zu stürzen.
Der Kapitalismus kann nicht reformiert werden – aber er kann leerlaufen, wenn sich die Menschen seinem innersten Motor – dem Zwang zur Lohnarbeit – kollektiv entziehen.
7. Der Tag der Umstellung – der Übergang in die klassenlose Gesellschaft
Am Tag der weltweiten Umstellung auf freiwillige Arbeit muss alles weiterlaufen wie bisher – ruhig, geordnet, ohne sichtbare Unterbrechung, damit die Versorgung nicht gefährdet wird. Das ist möglich, weil alle bestehenden Arbeits- und Lieferverträge gültig bleiben, nur dass keine Zahlungen mehr erfolgen.
Die Preise entfallen ersatzlos, da die Arbeit freiwillig geschieht und somit kein Tauschwert mehr entsteht. Rohstoffe sind Geschenke der Natur, und freiwillige Arbeit fügt keinen finanziellen Wert hinzu – Produkte werden kostenlos. Die Versorgung bleibt vollständig gesichert, die Produktionsketten intakt. Niemand muss verzichten.
Statt Unsicherheit entsteht Freude. Wir erhalten alles, was wir brauchen, ohne Bezahlung. Durch den Wegfall der Profite entfällt die Aufforderung zu mehr Konsum und die Wirtschaft beginnt damit, sich nachhaltig zu entwickeln.
Diese Erfahrung kollektiver Befreiung hebt das gesellschaftliche Glücksgefühl augenblicklich. Die Wirtschaft funktioniert weiter, wie auch vorher – aber ohne Profit, ohne Geld, ohne Ausbeutung. Ein stiller, globaler Übergang in die klassenlose Gesellschaft.
Am 1. Mai 2026 könnte bereits diese weltweite Umstellung stattfinden.
ErläuterungenRead More
Wegen der globalen Verflechtung der Warenketten ist eine punktuelle Veränderung undenkbar. Nur eine weltweit gleichzeitige Umstellung garantiert, dass Rohstoffe, Zwischenprodukte, Ersatzteile, Fertigwaren und Dienstleistungen überall gleichzeitig ihren finanziellen Wert verlieren – und damit kostenlos verfügbar werden.
Die heutige Weltwirtschaft basiert auf globalen Lieferketten – darum ist es entscheidend, dass die Umstellung weltweit und gleichzeitig erfolgt. Nur so kann verhindert werden, dass Profitlogik, Eigentumstitel oder Marktmechanismen erneut die Oberhand gewinnen. Marx selbst ging von einer weltweiten Revolution aus – heute kann sie friedlich erfolgen.
Voraussetzung ist Kontinuität
Am Tag der Umstellung darf sich im Alltag der Menschen nichts spürbar ändern. Das Leben muss so weitergehen, als wäre nichts geschehen, damit die Versorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet wird und keine Panik entsteht.
Es handelt sich um eine stillschweigende Übereinkunft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Bisher wurde die Arbeit vorgeschossen bis der Lohn gezahlt wurde und nun erfolgt die kostenlose Herausgabe der Produkte zeitgleich mit der kostenlos geleisteten Arbeit.
Alle bestehenden Arbeits-, Liefer- und Dienstleistungsverträge behalten ihre Gültigkeit. Die Arbeit verläuft weiter wie bisher – nur ohne Lohnzahlung, was wir nicht wirklich realisieren, da ja die Löhne ohnehin mit Zeitverzögerung gezahlt werden würden. Alle Produktionsketten bleiben übergangsweise bestehen.
Der Unterschied ist, dass die Preise vollständig entfallen. Alle Produkte und Dienstleistungen werden kostenlos, weil keine bezahlte Arbeit mehr stattfindet und somit kein Tauschwert entsteht. Die Arbeit wird zu einem Geschenk – und dieses gegenseitige Geschenkverhalten verändert alles.
Das Erste, was wir bemerken werden ist, dass in den Geschäften die Produkte nichts mehr kosten, wenn wir nach Feierabend unsere Besorgungen machen. Da wir auf diesen Tag vorbereitet sind, werden wir nicht auf den Fehler verfallen, zu hamstern. Wir müssen das nicht, weil von diesem Tage an alles, was wir benötigen, kostenlos ist. Alles, was wir für ein glückliches und zufriedenes Leben benötigen, bekommen wir geschenkt und es gibt keine Bedrohung mehr, seine Existenz zu verlieren.
Deshalb werden unsere Entscheidungen in Zukunft im Sinne der gegenseitigen Hilfe und Solidarität erfolgen.
Das gesellschaftliche Glücksgefühl
Diese plötzliche Befreiung von ökonomischem Druck führt unmittelbar zu einer signifikanten Steigerung des gesellschaftlichen Glücks. Menschen erhalten, was sie brauchen, ohne bezahlen zu müssen, als Geschenke, über die wir uns naturgemäß freuen. Aus Gier wird Großzügigkeit, aus Knappheit Fülle.
Selbst die Unternehmer*innen profitieren: Sie müssen keine Kredite mehr bedienen, keine Löhne zahlen, keine Preise kalkulieren. Die Buchhaltung wird überflüssig. Sie erhalten alles, was sie brauchen, ebenfalls kostenlos – wie alle anderen.
Damit fällt auch für sie der Zwang zur Kapitalverwertung. Viele werden sich über den gewonnenen Sinn und die entfallene Verantwortung für Konkurrenz, Kündigungen und Marktzwänge freuen.
Diese Form des Übergangs vermeidet radikale Systembrüche oder Gewalt.
Schrumpfung des Konsums und ökologische Entlastung
Ohne Profitlogik entfallen künstlich erzeugte Nachfrage und geplante Obsoleszenz. Es wäre unsinnig, mehr zu verschenken als nötig. Deshalb wird weniger konsumiert und der Bedarf sinkt augenblicklich. Deshalb kann die Produktion auf das gesellschaftlich Notwendige schrumpfen.
Menschen aus überflüssigen Branchen – etwa dem Finanz- oder Versicherungssektor – helfen dort mit, wo sie gebraucht werden: bei der Grundversorgung. Arbeitslosigkeit ist kein Problem mehr, denn alle sind automatisch versorgt.
Digitale Steuerung statt Marktlogik
Künstliche Intelligenz und die weltweite Vernetzung helfen, Güter bedarfsgerecht zu verteilen. Diese Werkzeuge ersetzen den Markt und ermöglichen eine gerechte, transparente Versorgung. Diese Instrumente werden demokratisch überwacht und kontrolliert.
Eine friedliche Revolution
Die Kraft dieser Lösung liegt in ihrer Einfachheit. Es braucht keine vorbereitenden Umstürze, keine gewaltsame Enteignung. Nur einen weltweiten gemeinsamen Entschluss, am selben Tag auf freiwillige Arbeit umzustellen. Dann wird aus der kapitalistischen Verwertungslogik eine menschliche Schenkökonomie und der Übergang in die klassenlose Gesellschaft ist Realität.
8. Organisatorische Voraussetzungen für den globalen Übergang zur klassenlosen Gesellchaft
Die Menschheit befreit sich in einem Akt kollektiver Selbstermächtigung vom Joch des Finanzsystems. Ein weltweiter Generalstreik könnte dazu führen, auf freiwillige Arbeit umzusteigen. Anstatt die Arbeit niederzulegen, würden alle Menschen ohne Lohn weiterarbeiten. Dadurch entsteht kein Tauschwert mehr und alle Güter werden zu Gemeingütern. Preise, Löhne und Profite verschwinden und das Geldsystem löst sich auf.
Produktion, Logistik und Versorgung bleiben erhalten – nur der Geldfluss versiegt. Der Profitzwang entfällt, der Konsum sinkt freiwillig. In einer Atmosphäre des Schenkens realisiert sich die klassenlose Gesellschaft nicht durch Umsturz, sondern durch bewusste Praxis. Menschenrechte werden universell verwirklicht. Der Kapitalismus stirbt nicht im Kampf – er versiegt im Akt des Gebens.
Die Voraussetzung ist die globale, zeitgleiche Umsetzung.
Mit einem globalen Generalstreik könnte das erreicht werden.
ErläuterungenRead More
Wie kann die Menschheit motiviert werden, weltweit freiwillig zu arbeiten?
Die Vorstellung, dass die gesamte Menschheit von einem Tag damit beginnt, freiwillig zu arbeiten, erscheint auf den ersten Blick unrealistisch. Viele können sich schwer vorstellen, dass eine solch fundamentale Veränderung friedlich umsetzbar wäre.
Unabhängig von der Tatsache autoritärer Kontrolle durch den Staat und der Profitsicherung für Pharmakonzerne können wir aber auch eine Lehre aus der Corona-Pandemie zu Beginn 2020 ziehen. Sie bewies, dass global koordinierte Maßnahmen möglich sind. Innerhalb weniger Tage wurden wirtschaftliche Sektoren wie Luftfahrt und Automobilindustrie stillgelegt, ohne dass die Grundversorgung zusammenbrach.
Die arbeitende Bevölkerung verhielt sich weltweit überwiegend diszipliniert, solidarisch und umsichtig. Trotz Aushöhlung demokratischer Rechte und der Technokratisierung des Lebens bewies die Pandemie: Wenn Menschen ein gemeinsames Ziel erkennen, können sie weltweit kooperieren.
Dieses historische Beispiel zeigt, dass auch ein gleichzeitiger, weltweiter Übergang zu einer geldfreien Ökonomie der freiwilligen Arbeit denkbar ist – wenn Einsicht, Solidarität und globale Koordination zusammentreffen.
Ein Mittel des kollektiven Handelns wäre ein weltweiter Generalstreik Ein Generalstreik ist in der Geschichte stets ein machtvolles Werkzeug gewesen, um soziale Forderungen durchzusetzen. Üblicherweise geht es um höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen oder den Protest gegen staatliche Einschränkungen.
Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht um Druck auf einzelne Arbeitgeber oder Regierungen, sondern um eine kollektive Befreiung der Menschheit vom Einfluss des Finanzsystems auf die Wirtschaft.
Die Motivation für diesen besonderen „Streik“ könnte daher aus einem radikalen Gleichheitsanspruch erwachsen: Die Forderung, dass niemand – ob arbeitslos oder beschäftigt – benachteiligt sein darf. Denn nur auf dieser Grundlage kann sich Arbeit wirklich gleichmäßig verteilen.
Diese Gleichheit kann nur durch Freiwilligkeit geschaffen werden, wenn sich alle Menschen gegenseitig versorgen, anstatt über Geld zu konkurrieren.
Dieser neue Generalstreik hätte demzufolge ein völlig anderes Ziel: Nicht die Arbeit wird niedergelegt, sondern die Menschheit beginnt gleichzeitig damit, freiwillig weiterzuarbeiten, ohne Lohn, ohne Bezahlung. Der Lohn entfällt, aber die Arbeit, die natürlich gesellschaftlich notwendig ist, bleibt.
Die Verträge, die Lieferketten, die Produktionsprozesse – all das, was heute selbstverständlich ist, bleibt erst einmal für eine begrenzte Zeit bestehen, um den nahtlosen Übergang sicherzustellen. Nur der Geldfluss hört auf. Die Beschäftigten werden davon überhaupt nichts bemerken, denn üblicherweise werden die Löhne mit Zeitverzögerung gezahlt.
Es wird keine Aufforderung mehr geben, dass wir uns mehr nehmen, als wir für ein zufriedenes Leben brauchen, denn das wäre bei Geschenken vollkommen fehl am Platze. Deshalb wird der Konsum augenblicklich abnehmen, ohne dass es zu einer Krise in der Wirtschaft kommt, denn die Unternehmen stehen nicht mehr unter dem Druck, Profit erzeugen zu müssen.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden sich ebenfalls schlagartig ändern, weil das gesellschaftliche Glücksgefühl mit dem täglichen Erhalt der Geschenke automatisch ansteigt. Deshalb werden wir hauptsächlich solidarisch miteinander umgehen und versuchen, die Menschen so schnell wie möglich zu entlasten, die in diesem Moment noch hohem Druck in der Wirtschaft ausgesetzt sind.
Das gesellschaftliche Glücksgefühl würde auch deshalb augenblicklich steigen, weil niemand mehr von Menschenrechten wie Obdach, Nahrung und medizinischer Versorgung ausgeschlossen ist.
Was als utopischer Gedanke beginnt, könnte sich über die globale Organisation eines Generalstreiks in eine neue Form des solidarischen Wirtschaftens verwandeln – ohne Revolution, ohne Gewalt, sondern durch bewusste Selbstermächtigung der Menschheit.
9. Künstliche Intelligenz ersetzt den Markt
In einer geldfreien Gesellschaft ersetzt die demokratisch kontrollierte künstliche Intelligenz (KI) den Markt als Steuerungsmechanismus. Entnahmen und Bedarfe werden digital erfasst, just-in-time koordiniert und durch intelligente Systeme an Produktionsstätten, Lager, Ausgabestellen und an die Zivilgesellschaft weitergegeben. Statt am Profit orientiert sich die Produktion am tatsächlichen Bedarf.
Verträge bleiben zunächst bestehen, werden aber schrittweise durch kooperative Vereinbarungen ersetzt. KI ermöglicht Transparenz, Effizienz und demokratische Mitbestimmung.
Auf Grund des nachlassenden Rohstoffbedarfs ist eine Allokation über einen Markt nicht mehr erforderlich.
ErläuterungenRead More
Im Kapitalismus ist die Produktion auf Profit ausgerichtet. Angebot und Nachfrage erscheinen als naturwüchsige Kräfte, obwohl sie durch Werbung, Preisdruck, Konkurrenz, Knappheit und Spekulation verzerrt werden.
In einer auf freiwilliger Arbeit basierenden Wirtschaft jedoch fällt das Profitmotiv weg, und mit ihm die Notwendigkeit, Konsum künstlich anzuregen. Die Produktion richtet sich dann nicht mehr nach dem Markt, sondern nach realem gesellschaftlichem Bedarf.
Heute kann uns die Künstliche Intelligenz (KI) bei der gerechten Verteilung helfen.
Just-in-Time statt Fünfjahresplan
Die alte Vorstellung zentraler Planwirtschaft mit starren Produktionszielen ist überholt. In einer vernetzten Welt, in der alle Produktions- und Verbrauchsdaten digital erfasst werden können, ist es möglich, dynamisch auf Veränderungen zu reagieren – in Echtzeit.
Jede Entnahme von Gütern, sei es ein Lebensmittel oder ein Ersatzteil, erzeugt heute bereits digitale Signale: Kassensysteme, Lagerlogistik und Bestellsysteme kommunizieren miteinander. Auch Wohngemeinschaften oder Menschen können so ihren Bedarf an Leistungen, z.B. Reparaturen anmelden.
In der marktfreien Wirtschaft würden diese Signale weiter genutzt, aber nicht zur Preisbildung oder Profiterwartung, sondern zur reinen Bedarfsanalyse. Die KI erfasst, was gebraucht wird, erkennt Muster, gleicht regionale Unterschiede aus und gibt Handlungsempfehlungen an die Produzierenden, bis hin zu zivilgesellschaftlichem Potential wie Reparaturcafes.
Dezentrale Koordination statt Markt
Anstelle eines anonymen, unkontrollierbaren Marktes tritt ein transparentes, kooperatives Netzwerk, welches demokratisch überwacht wird. Produktionsstätten, Lager, Ausgabestellen und Reparaturzentren sind digital verknüpft. Schnittstellen zwischen Betrieben bleiben erhalten, doch die Bestellung erfolgt nicht mehr durch „Kauf“, sondern durch Bedarfsmeldung.
Die Lieferverträge, die vor der Umstellung galten, können zunächst weiterlaufen, sie werden allmählich durch neue Kooperationsvereinbarungen ersetzt, die auf Solidarität und gemeinsamer Verantwortung beruhen.
KI kann dabei helfen, Prozesse zu optimieren, Verschwendung zu minimieren und Energieeinsatz zu senken. Sie erkennt Wartungsbedarf, koordiniert Transporte und hilft dabei, Ressourcen schonend und effizient einzusetzen. In Bereichen, in denen Automatisierung noch nicht möglich ist, können Menschen freiwillig tätig werden – motiviert nicht durch Zwang, sondern durch Sinnstiftung und soziale Anerkennung.
Demokratische Steuerung und Mitbestimmung
Die digitale Vernetzung schafft auch neue Möglichkeiten demokratischer Beteiligung. Regionale Versorgungsräte, Plattformen für Prioritätensetzung, kollektive Rückmeldesysteme – all das lässt sich mit heutigen Technologien abbilden. Die Menschen können direkt mitentscheiden, was wie und wo produziert wird. Die KI dient dabei als Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung – nicht als Herrscherin.
Schrumpfende Wirtschaft – wachsendes Leben
Ohne Werbung, geplante Obsoleszenz und Konkurrenzdruck wird weniger produziert – und zwar genau das, was gebraucht wird. Die KI erkennt, wenn die Nachfrage sinkt, und reduziert die Produktion entsprechend. Ressourcen werden geschont, die Umwelt entlastet, das Klima geschützt. Die schrumpfende Wirtschaft ist kein Zeichen der Krise, sondern der Befreiung. Denn: Je weniger gearbeitet werden muss, desto mehr Zeit bleibt für das Leben.
10. Die Rolle des Eigentums in der klassenlosen Gesellschaft
Im Kapitalismus dient Eigentum primär der Profiterzeugung. Wird Profit unmöglich – durch Abschaffung des Finanzsystems und des Geldes – verliert Eigentum seine Funktion und löst sich auf.
Eine staatliche Vergesellschaftung reicht dazu nicht aus, weil sie Besitz nur anders verwaltet. Eigentum verschwindet nicht durch Enteignung, sondern durch Zwecklosigkeit.
Nur durch die vollständige Überwindung des Finanzsystems kann die Trennung von Besitzenden und Besitzlosen überwunden werden. Das Ziel ist nicht kollektives Eigentum – sondern kein Eigentum mehr. Es wird dann wieder zu Allmende und nur noch von den Nutzern verwaltet.
Der Schutz der Privatsphäre ist gewährleistet, denn wenn keine ökonomischen Interessen mehr hinter Grundbesitz und Wohnraum stehen, kann die Privatsphäre freier und selbstbestimmter gestaltet werden.
ErläuterungenRead More
Im Kapitalismus ist Eigentum nicht bloß ein Mittel individueller Absicherung, sondern das zentrale Instrument zur Profitmaximierung. Ob Fabriken, Mietwohnungen oder brachliegendes Land – Eigentum existiert, um Kapital zu akkumulieren.
Auch eine selbstgenutzte Eigentumswohnung erzeugt Profit, weil keine Miete gezahlt werden muss und das gesparte Geld anderweitig eingesetzt werden kann. Sogar unbewirtschaftetes Land steigert durch künstliche Verknappung der restlichen Fläche die Grundstückspreise – ebenfalls im Dienste der Verwertung.
Eigentum entstand historisch nicht, weil Menschen sagen wollten: „Das gehört mir“, sondern um andere zur Arbeit für sich zu zwingen. Vor dem Privateigentum war Land Gemeingut. Der Zaun um das Land bedeutete nicht Schutz, sondern Herrschaft: Er markierte die Grenze, an der die Ausbeutung begann.
Die Rolle des Profits – und seine Auflösung
Die entscheidende Frage ist: Wie lässt sich diese Logik überwinden? Die Antwort liegt nicht in Enteignung der Produktionsmittle, sondern in der Abschaffung des Profits selbst. Ohne Profit verliert Eigentum seine zentrale Funktion als Herrschaftsinstrument. Es wird funktionslos.
Eigentümer*innen haben dann keinen Anreiz mehr, Besitz zu halten, da sie ihn nicht mehr verwerten können, aber weiterhin für Erhalt, Verwaltung und Risiko verantwortlich sind. Da sie ihn auch nicht verkaufen können – weil es keinen Markt mehr gibt – bleibt ihnen nur, ihn freizugeben. So wird Eigentum nicht vergesellschaftet, sondern schlicht überflüssig. Es löst sich auf – nicht durch Zwang, sondern durch Wegfall seines Zwecks.
Damit kehrt das Verhältnis der Menschheit zu Besitz und Eigentum zu einem Zustand zurück, der über 95 % ihrer Geschichte vorherrschte: Gemeingut statt Privateigentum. Produktionsmittel, Rohstoffe, Wasserquellen oder Erzminen werden automatisch wieder frei nutzbar. Es braucht weder privaten noch gemeinschaftlichen Besitz, da alles nach Bedürfnis geteilt und genutzt wird. Die alte Trennung zwischen Besitzenden und Besitzlosen verliert jede materielle Grundlage.
Keine Aneignung
Auch gut gemeinte Modelle kollektiven Eigentums, etwa durch demokratische Räte oder Genossenschaften, führen nicht zur Überwindung der Eigentumslogik. Sie verwalten Besitz lediglich anders – oft gerechter –, aber sie lösen ihn nicht auf. Selbst unter dem Schlagwort der Vergesellschaftung bleibt Eigentum bestehen, nur in anderer Form.
Die Vergesellschaftung bedeutet auch eine bewusste und oft gewaltsame Aneignung der Produktionsmittel – sie steht damit im Widerspruch zu einem allgemeinen Gerechtigkeitssinn, der Zwangsenteignung ablehnt. Der Gedanke, dass sich Eigentum durch Funktionsverlust von selbst auflöst, ist deshalb nicht nur praktikabler, sondern auch moralisch überzeugender.
Dafür braucht es einen qualitativen Sprung: die vollständige Entkopplung der Wirtschaft vom Finanzsystem. Nur so kann Eigentum als soziales Machtverhältnis verschwinden.
Vergesellschaftung führte zu Staatssozialismus
Im real existierenden Sozialismus wurden Produktionsmittel und Wohnraum formal zu Volkseigentum erklärt. Doch faktisch hatten die Menschen keinen wirklichen Zugriff darauf. Das „Volkseigentum“ blieb fremdes Eigentum.
Daraus folgte häufig Vernachlässigung, denn niemand fühlte sich individuell verantwortlich. Die Eigentumsfrage wurde nicht grundsätzlich gelöst – sondern das Eigentum lediglich umverteilt. Das offenbarte sich spätestens 1989: Was angeblich allen gehörte, wurde ganz unspektakulär wieder in Privateigentum umgewandelt – als wäre nichts gewesen.
Das Problem: Solange Eigentum juristisch definierbar bleibt – selbst als Staatseigentum –, kann es auch wieder privatisiert werden. In einem System ohne Eigentum dagegen fehlt die rechtliche Infrastruktur, um Besitz zu übertragen. Wenn niemand das Land „besitzt“, kann es auch nicht verkauft werden. Die Vorstellung eines Markts ist damit gegenstandslos.
Schutz der Privatsphäre
Auch in einer Gesellschaft ohne Eigentum bleibt der Schutz der Privatsphäre ein zentrales Anliegen. Der Wegfall des Besitzes bedeutet keineswegs die Aufhebung persönlicher Räume oder individueller Rückzugsorte. Im Gegenteil: Wenn keine ökonomischen Interessen mehr hinter Grundbesitz und Wohnraum stehen, kann die Privatsphäre freier und selbstbestimmter gestaltet werden.
Niemand wird mehr gezwungen, Räume zu teilen, die er oder sie nicht teilen möchte, nur weil Eigentum oder Mietpreise es diktieren. Menschen wählen ihre Wohnorte, Mitbewohner*innen und Lebensformen freiwillig – und aus sozialen, nicht aus finanziellen Gründen. Persönlicher Raum wird nicht vergesellschaftet, sondern respektiert, weil keine Notwendigkeit mehr besteht, ihn zu kontrollieren oder ökonomisch zu verwerten.
Technologische Hilfsmittel, etwa im Bereich der Kommunikation oder automatisierten Versorgung, werden so gestaltet, dass sie individuelle Sphären achten und nicht überwachen. Eine Welt ohne Eigentum kann somit zugleich eine Welt mit größerer Achtung vor der Privatsphäre sein – weil sie nicht länger durch Besitzinteressen verletzt wird.
Schlussfolgerung
Die einzige Lösung liegt in der vollständigen Überwindung von Finanzsystem und Profit. Erst wenn der Profit als Motor der Verwertung verschwindet, lösen sich Eigentumsverhältnisse auf – nicht durch Gesetze, Enteignung oder Umverteilung, sondern durch Entwertung ihrer Grundlage. Eigentum verliert seine Funktion und fällt in sich zusammen. Was bleibt, ist eine freie, gemeinsame Nutzung der Ressourcen – eine Welt ohne Eigentum, ohne Profit, ohne Klassen.
Die Vermeidung von erzwungenen Enteignungen wird auch gewährleisten, dass der Übergang in die klassenlose Gesellschaft gewaltlos abläuft.
11. Die Befreiung der Arbeit
In der klassenlosen Gesellschaft ohne Geld und Profit entfällt der Arbeitszwang. Arbeit wird freiwillig, kreativ und sinnstiftend – nicht mehr Mittel zum Überleben, sondern Ausdruck menschlicher Freiheit.
Die von Marx analysierte Entfremdung endet, da alle Mitglieder der Gesellschaft gemäß ihren Fähigkeiten tätig sein können. Roboter übernehmen belastende Arbeiten, globale Ausbeutung wird überflüssig.
Viele Menschen zweifeln daran, dass wir freiwillig arbeiten würden. Der menschliche Trieb zur freiwilligen, gemeinschaftsdienlichen Arbeit ist jedoch evolutionär tief verwurzelt und zeigt sich bis heute in Formen wie Fürsorge, Ehrenamt und spontaner Hilfe, z.B. bei Katastrophen.
Neurowissenschaftliche und verhaltensökonomische Studien belegen, dass Kooperation und Geben intrinsisch belohnend wirken – unabhängig von Geldanreizen. Besonders im Globalen Süden ist freiwillige und unbezahlte Arbeit oft der Normalfall – dort wird ein Großteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit nicht über Geld geregelt.
Solange Arbeit verrechnet wird – ob in Geld oder Zeit –, bleibt die Gesellschaft in der bürgerlichen Verwertungslogik. Erst wenn nach Bedürfnissen statt nach Leistung verteilt wird, beginnt eine wahrhaft postkapitalistische Ordnung. Arbeitszeitrechnung ist kein Bruch mit dem Kapitalismus, sondern dessen technischer Umbau.
ErläuterungenRead More
Freiwillige Arbeit statt Lohnabhängigkeit
Wenn Arbeit nicht mehr dem finanziellen Zwang unterliegt, sondern freiwillig geleistet wird, verändert sich ihr gesamter Charakter. Sie wird Ausdruck von Kreativität, Selbstverwirklichung und gesellschaftlichem Beitrag. Die Motivation entspringt nicht mehr dem Überlebensdruck, sondern der Freude an der Tätigkeit selbst.
Dies markiert den historischen Bruch mit der kapitalistischen Lohnarbeit.
Es gibt überzeugende Argumente und auch empirische Hinweise darauf, dass der Trieb zur freiwilligen, gemeinschaftsdienlichen Arbeit tief im Menschen verwurzelt ist – unabhängig von Geldanreizen. Das betrifft nicht nur anthropologische Beobachtungen, sondern auch Erkenntnisse aus Psychologie, Soziologie, Verhaltensökonomie und Neurowissenschaft.
In Urgesellschaften wurde Arbeit nicht durch Geld, sondern durch direkte Bedürfnisbefriedigung und sozialen Zusammenhalt motiviert. Kooperation war überlebenswichtig: Wer sich nicht einbrachte, wurde ausgegrenzt oder galt als unzuverlässig. Jagen, Sammeln, Kinderbetreuung, Schutz der Gruppe – all das geschah freiwillig, ohne Tausch oder Lohn. Der Trieb zur gemeinsamen Arbeit diente der Arterhaltung. Quellen wie Marshall Sahlins (1966: „The Original Affluent Society“) und Christopher Boehm („Hierarchy in the Forest“) belegen das eindrucksvoll.
Diese Bedingungen galten zu mehr als 95 Prozent der menschlichen Geschichte.
Auch moderne psychologische und neurowissenschaftliche Studien bestätigen, dass Altruismus und Kooperation Glückshormone wie Oxytocin und Dopamin auslösen. Freiwilliges Helfen aktiviert Belohnungszentren im Gehirn – vergleichbar mit Essen oder Sex.
Der sogenannte „Helper’s High“ ist wissenschaftlich belegt, unter anderem in einer Studie von Jorge Moll et al. (2006), im Buch von Sonja Lyubomirsky („The How of Happiness“) und in der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan zur intrinsischen Motivation.
Weltweit leisten mehrere Milliarden Menschen freiwillig und unbezahlt Arbeit: Katastrophenhilfe, Vereinsarbeit, Pflege, Nachbarschaftshilfe, Tierschutz, politische Bewegungen – diese Arbeit geschieht nicht wegen Geld, sondern aus sozialer Verantwortung, Freude, Sinn oder Gewohnheit.
In Deutschland engagieren sich laut Statistischem Bundesamt (2022) ca. 30 Millionen Menschen ehrenamtlich, in der Schweiz etwa 40 % der Bevölkerung. Besonders im Globalen Süden ist freiwillige und unbezahlte Arbeit oft der Normalfall – dort wird ein Großteil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit nicht über Geld geregelt.
Zahlreiche Experimente aus der Verhaltensökonomie zeigen zudem, dass Menschen nicht nur auf Geldanreize reagieren. In sogenannten Public-Goods-Games leisten viele Teilnehmer freiwillige Beiträge zum Gemeinwohl, und bei Einführung von Geldanreizen sinkt oft sogar die Motivation – dieser Crowding-Out-Effekt wurde unter anderem von Fehr & Gächter (2002: „Altruistic punishment in humans“) und Gneezy & Rustichini (2000: „Pay Enough or Don’t Pay at All“) untersucht.
Auch Kinder zeigen diesen Impuls: Sie spielen Arbeit – bauen, versorgen, organisieren – ohne dafür belohnt zu werden. In vielen Kulturen helfen Kinder ab einem gewissen Alter freiwillig mit, z. B. bei der Ernte, beim Wasserholen, im Haushalt – weil es zur Gemeinschaft gehört. Anthropologische Beobachtungen wie jene von Jean Liedloff („The Continuum Concept“) und Barry Hewletts Forschung über die Aka im zentralen Afrika bestätigen das eindrucksvoll.
In Extremsituationen und Krisen helfen Menschen oft spontan und freiwillig, auch unter Lebensgefahr. Beispiele dafür sind die Nachbarschaftshilfe in der Coronakrise, die Solidarität nach Naturkatastrophen oder die Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten.
Der Trieb zur freiwilligen Arbeit im Dienste der Gemeinschaft ist also evolutionär tief verankert und kulturell lebendig geblieben. Er äußert sich in Formen, die nicht an Geld gebunden sind: Pflege, Fürsorge, Kreativität, Aufbauarbeit, gegenseitiges Helfen. Dieser Trieb ist keine Utopie, sondern tägliche Realität – er wird nur oft von Geldlogik überdeckt oder verzerrt.
Wenn äußere Zwänge wie Geld wegfallen, würde dieser innere Antrieb vermutlich wieder stärker sichtbar und wirksam.
Die Überwindung der Entfremdung
Karl Marx kritisierte die kapitalistische Arbeit als entfremdet, da sie den Menschen von seinem Produkt, seiner Tätigkeit, seinen Mitmenschen und sich selbst trennt. Erst durch die Abschaffung der Logik der Lohnarbeit kann die Arbeit wieder dem Menschen gehören.
Jede Person kann sich dann frei und selbstbestimmt für eine Tätigkeit entscheiden, die ihren Neigungen, Fähigkeiten und Talenten entspricht, ohne unter dem Zwang zu stehen, seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen.
In der klassenlosen Gesellschaft, in der das Finanzsystem und die Logik der Lohnarbeit überwunden sind, werden die meisten Menschen im Laufe der Zeit genau das tun können, was sie wirklich gerne machen – sei es backen, programmieren, pflegen gestalten oder sogar putzen. Wer gerne bäckt, wird auch ab und zu um vier Uhr morgens aufstehen, um Brötchen und Croissants für andere Menschen zu backen, nicht aus Zwang, sondern aus Lust an der Sache.
Auf diese Weise werden viele Arbeitsplätze von innen heraus besetzt – durch persönliche Begeisterung statt durch ökonomischen Druck. Wichtig ist, durch solidarischen Wechsel einer Eintönigkeit zuvorzukommen.
Solidarische Organisation unangenehmer Arbeiten
Für notwendige, aber unbeliebte Tätigkeiten, die weder von Freiwilligen noch von Maschinen übernommen werden können, entwickeln sich solidarische Rotationssysteme, die demokratisch gesteuert und solidarisch besetzt werden.
Die Entscheidung zur Teilnahme bleibt freiwillig, wird jedoch getragen von einem Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung, als Gegenleistung für die erhaltenen täglichen Geschenke auch etwas für die anderen zu tun. Die Verteilung erfolgt nicht über Lohnanreize, sondern über solidarische Prinzipien und Gemeinschaftsgefühl.
In einer vom Finanzsystem befreiten Wirtschaft kann der technologische Fortschritt endlich menschenzentriert genutzt werden. Roboter ersetzen nicht mehr Menschen aus Profitgründen, sondern übernehmen gezielt die körperlich belastendsten und monotonsten Arbeiten.
Schluss mit globaler Ausbeutung
Die heutige Weltwirtschaft basiert auf der Ausbeutung billiger Arbeitskraft, besonders im globalen Süden – etwa bei der Rohstoffgewinnung oder in der Textilproduktion. In der klassenlosen Gesellschaft wird dieses Verhältnis obsolet. Es spielt dann keine Rolle mehr, ob eine Hose von einem Menschen in Asien oder einem Menschen in Europa genäht wird.
Niemand muss mehr unter Zwang arbeiten. Sollten Menschen bestimmte Tätigkeiten verweigern, wird das nicht als Problem, sondern als notwendige Korrektur einer historisch gewachsenen Ungerechtigkeit verstanden und es werden auf demokratischem Wege Lösungen gesucht.
Neue Unternehmensformen – ohne Profit, ohne Ausbeutung
In einer postkapitalistischen Produktionsweise verdient niemand mehr an Unternehmen. Damit entfällt der ökonomische Anreiz zur Ausbeutung. Unternehmer:innen handeln dann nicht mehr als Kapitaleigner:innen, sondern als Koordinator:innen sinnvoller Prozesse.
Sie gestalten nachhaltige Produktionsformen gemeinsam mit den anderen Beschäftigten, die aus freien Stücken im Unternehmen bleiben oder wechseln – je nachdem, wo sie ihre Fähigkeiten am besten entfalten können.
Im überwiegenden Teil der Unternehmen werden sich die Unternehmer:innen schnell den neuen Verhältnissen anpassen und die Befreiung vom Profitzwang als Befreiung von einer Last empfinden.
Zur Arbeitszeitrechnung
Wie Marx in der Kritik des Gothaer Programms betont, ist die Arbeitszeitrechnung – also die Zuteilung von Konsumtionsmitteln proportional zur individuell geleisteten Arbeitszeit – ein Relikt aus der alten bürgerlichen Gesellschaft. Sie entspringt, wie er schreibt, der „ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft“, die „noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft“ (MEW 19, 20).
Diese Form der Verteilung bleibt dem Prinzip des Äquivalententauschs verhaftet: „Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warenaustausch regelt, soweit er Austausch Gleichwertiger ist“ (ebd.).
Inhaltlich handelt es sich also nicht um eine echte Überwindung des Kapitalismus, sondern um eine transformierte Fortführung seiner zentralen Logik: Leistung wird gemessen, bewertet, verrechnet und vergütet – nicht mehr in Geld, aber in Arbeitszeit. Es gibt zwar keinen Mehrwert doch die Arbeitszeit bleibt ein abstrakter Maßstab, der Ungleichheiten nicht aufhebt, sondern in anderer Form reproduziert.
Marx erkennt klar: „Dies gleiche Recht ist ungleiches Recht für ungleiche Arbeit […] Es ist daher ein Recht der Ungleichheit, seinem Inhalt nach, wie alles Recht“ (ebd., S. 21). Die Arbeitszeitrechnung verallgemeinert den Menschen als Arbeitskraft und reduziert ihn auf diese Funktion – unabhängig von seiner Lebensrealität, seinen Bedürfnissen oder seiner familiären Situation.
Friedrich Engels ergänzt diese Kritik und warnt vor der Überbetonung formaler Gleichheit, wie sie auch in der Arbeitszeitrechnung sichtbar wird. In einem Brief an August Bebel nennt er die Gleichheitsvorstellung der französischen Sozialisten „eine einseitige“ und „verwirrende“ Idee, die überwunden werden müsse (MEW 34, 129). Auch die Arbeitszeitrechnung operiert mit einer falschen Gleichheitsvorstellung, die faktisch zu Ungleichheit führt.
Zur Akkumulierbarkeit von Arbeitszeit-Zertifikaten
Ein weiterer wesentlicher Einwand gegen die Arbeitszeitrechnung ist strukturell: Auch wenn Vertreter dieser Idee betonen, es handle sich nicht um Geld sondern um „Gutscheine“ die nach Gebrauch vernichtet werden, so reproduziert sie doch eine zentrale Schwäche des Geldes – seine unendliche Akkumulierbarkeit. Eine beliebig große Zahl an Arbeitsstunden lässt sich ebenso einfach auf einem Zettel notieren oder in einer digitalen Datenbank speichern wie eine beliebig große Geldsumme.
Dies schafft dieselbe Möglichkeit zur Privilegierung durch Hortung. Ein Individuum kann, durch besonders intensive oder lange Arbeit oder durch besonders privilegierte Tätigkeiten einen Überhang an Arbeitszeitgutschriften ansammeln – ganz analog zur Kapitalakkumulation. Die Ungleichheit wird dadurch nicht aufgehoben, sondern lediglich in einer neuen Form organisiert.
Somit ist Arbeitszeit als Tauschmittel nichts anderes als eine andere Form von abstraktem Wert, die denselben sozialen Spaltungsmechanismen unterliegt wie Geld.
12. Wegfall kapitalistischer Sozialsysteme
In einer Gesellschaft, in der alle Menschen uneingeschränkten Zugang zu allem Lebensnotwendigen haben, wird die Notwendigkeit für kapitalistische Sozialsysteme wie Arbeitslosen- Kranken- und Rentenversicherung, und die Verwaltung über Steuern und der Zwang zur Arbeit durch das Finanzsystem überflüssig.
Stattdessen entstehen neue Formen der kollektiven Verantwortung und Selbstorganisation, die auf den Prinzipien der Solidarität und der freiwilligen Arbeit basieren.
Die freiwillige Arbeit und die daraus folgende kostenlose Verfügbarkeit der Waren gewährleistet, dass jeder Mensch vom Kind bis zum Rentner bedingungslosen Zugang zu allem hat, was für ein zufriedenes und glückliches Leben nötig ist.
ErläuterungenRead More
In einer Gesellschaft, in der jeder Mensch uneingeschränkten Zugang zu allem Lebensnotwendigen hat, entfällt die Notwendigkeit für die traditionellen kapitalistischen Sozialsysteme, die auf der Organisation und Verwaltung von Armut und Ungleichheit beruhen. Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherungen verlieren ihren Zweck, weil die Frage des Existenzminimums und der sozialen Absicherung nicht mehr über Löhne und Einkünfte geregelt wird.
Diese Systeme entstanden ursprünglich im Kapitalismus, um die existenzielle Unsicherheit der Arbeiterklasse zu mildern, während gleichzeitig das kapitalistische Produktionssystem und die Arbeitskraft als Ware erhalten bleiben sollten. Der Staat – oder vielmehr das bestehende System – fungiert hier als Vermittler, der sicherstellt, dass die Arbeiter weiterhin für das Kapital arbeiten können.
In der kapitalistischen Gesellschaft sind die Sozialsysteme an das Wirtschaftswachstum gekoppelt, da die Höhe der Abgaben durch die Gehälter der Arbeitnehmer festgelegt ist. Das bedeutet, dass bei abnehmendem Wirtschaftswachstum auch die Sozialleistungen schrumpfen. Auf Grund dieser Aneinanderkettung werden die Beschäftigten gezwungen, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und eine Automatisierung der Wirtschaft zu verhindern.
In einer Gesellschaft ohne Profit- und Lohnarbeit jedoch, in der die Produktion auf freiwilliger Basis erfolgt und jeder Mensch unabhängig vom Arbeitsmarkt Zugang zu den notwendigen Ressourcen hat, erübrigt sich der gesamte bürokratische Apparat, der zur Aufrechterhaltung dieser Sozialsysteme notwendig war. Denn es besteht für alle Menschen der bedingungslose Zugang zu allem, was für ein glückliches und zufriedenes Leben nötig ist.
In einer solchen Gesellschaft erübrigen sich also Arbeitslosenversicherungen, die ursprünglich dazu dienten, die prekäre Existenz von Arbeitern in Zeiten der Arbeitslosigkeit abzufedern. Denn in einer Gesellschaft, in der jeder Mensch durch freiwillige Arbeit und das Prinzip des Gebens versorgt wird, entfällt dieser Mechanismus der sozialen Sicherheit, der auf der fortwährenden Notwendigkeit der Lohnarbeit aufbaut.
Das gleiche gilt für das System der Rentenversicherung. In einer Gesellschaft, in der alle Menschen automatisch versorgt sind, gibt es keine Notwendigkeit für das Ansparen von Geldern für das Alter. Es gibt keine sozialen Klassen, die durch den Zwang zur Lohnarbeit und den damit verbundenen existenziellen Druck in unterschiedliche soziale Lagen aufgespalten werden. Alle sind gleich versorgt, unabhängig von ihrer Position im Arbeitsmarkt.
Verwaltung, Bildung und Kultur, die in kapitalistischen Gesellschaften oft als Sektoren betrachtet werden, die durch Steuern und staatliche Finanzierung gesichert werden, können nun in einer freiwilligen Gesellschaft auf völlig neue Weise organisiert werden. In einer Welt ohne finanzielle Zwänge und die Notwendigkeit, durch Steuern die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu decken, kann Bildung und Kultur frei und gleichberechtigt für alle zugänglich gemacht werden.
Kulturelle und soziale Arbeit als kollektive Verantwortung
Kultur, die in kapitalistischen Gesellschaften oft zur Ware gemacht wird, erfährt ebenfalls eine fundamentale Veränderung. Sie wird nicht mehr als Produkt der „Unterhaltungsindustrie“ oder als Statussymbol betrachtet, sondern als ein gemeinsames Gut, das der Gesellschaft dient und durch sie geschaffen wird.
In einer Gesellschaft ohne finanzielle Anreize sind die Menschen nicht mehr gezwungen, ihren Lebensunterhalt mit Tätigkeiten zu verdienen, die ihnen nicht entsprechen oder die nur dem Profit anderer dienen. Stattdessen können sie sich in kulturellen und kreativen Bereichen entfalten, ohne dabei von finanziellen Sorgen oder dem Zwang zur Kommerzialisierung betroffen zu sein.
13. Fortschritt ohne Zwang
Wettbewerb ist ein Produkt kapitalistischer Zwänge und nicht naturgegeben. Viele behaupten, dass nur Wettbewerb den Fortschritt vorantreiben würde aber echter Fortschritt entsteht aus der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und kooperativer Zusammenarbeit.
In einer klassenlosen Gesellschaft wird Innovation nicht durch Konkurrenz, sondern durch Sinn, Gemeinschaft und intrinsische Motivation gefördert. Open-Source-Projekte, Genossenschaften und freiwillige Forschung zeigen, dass Entwicklung auch ohne Rivalität möglich ist.
Wettbewerb erzeugt kurzfristigen Druck, aber langfristig soziale und ökologische Schäden. Kooperation dagegen ermöglicht nachhaltigen, solidarischen Fortschritt – besonders in einer vom Finanzsystem befreiten Gesellschaft.
ErläuterungenRead More
Echter Fortschritt ist nicht zwingend auf Konkurrenz und Wettbewerb angewiesen. Wettbewerb ist kein natürliches Prinzip, sondern ein spezifisches Merkmal kapitalistischer Produktionsverhältnisse, welches auf Adam Smith zurückgeht. Er resultiert aus dem Zwang zur Kapitalverwertung. Unternehmen konkurrieren um Absatzmärkte, Profite und Kostensenkung, nicht um den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Produkte oder Dienste. Der Kapitalismus produziert zwar technischen Fortschritt, aber er entsteht unter Bedingungen, die gleichzeitig Ausbeutung, Entfremdung und Krisen erzeugen.
Die wahre Triebkraft gesellschaftlicher Entwicklung liegt in der Entfaltung der Produktivkräfte – also Technologie, Wissen und menschlicher Arbeit – und in ihrer Verbindung mit den Produktionsverhältnissen. Im Kapitalismus geraten diese beiden Bereiche immer wieder in Widerspruch. Neue Technologien könnten das Leben erleichtern, führen aber oft zu Rationalisierung, Entlassung oder Entwicklung von Kriegstechnik.
Erst in einer klassenlosen, solidarischen Gesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln, also ohne Konkurrenzzwang, kann Fortschritt vollständig dem Gemeinwohl dienen.
Kooperative Formen der Arbeit können sogar effizienter und kreativer sein als Konkurrenzsysteme. In einer Welt, in der niemand mehr um Existenzsicherung kämpfen muss, können Menschen freier denken, forschen und Neues ausprobieren. Die Motivation entsteht dann nicht aus Angst oder Konkurrenzdruck, sondern aus intrinsischem Interesse, gesellschaftlichem Sinn und gegenseitiger Inspiration.
Die Wissenschaft, Kunst und Technik haben auch in vormodernen Gesellschaften oder in solidarischen Kollektiven Innovation hervorgebracht – nicht durch Konkurrenz, sondern durch Zusammenarbeit und geteiltes Wissen.
Beispiele aus der Realität zeigen, dass auch unter Nicht-Konkurrenzbedingungen enorme Fortschritte möglich sind: Open-Source-Software, Wikipedia oder freiwillige Forschung in der Wissenschaft basieren nicht auf wirtschaftlichem Wettbewerb, sondern auf Kooperation und Beitrag zum Gemeinwohl. Auch in klösterlichen Gemeinschaften, Genossenschaften oder indigenen Kulturen entstanden Innovationen – nicht trotz, sondern gerade wegen kollektiven Denkens.
Der Glaube, nur Wettbewerb schaffe Fortschritt, ist ein Mythos der bürgerlichen Ideologie. Wettbewerb erzeugt kurzfristige Effizienz, aber langfristig oft Ineffizienz durch Ressourcenverschwendung, geplante Obsoleszenz und soziale Spaltung.
Viel größer ist das Potenzial kooperativer Systeme. Menschen entwickeln mit Freude neue Lösungen, wenn sie den Sinn ihrer Arbeit sehen, sich anerkannt fühlen und sich mit anderen verbunden wissen. Fortschritt durch Kooperation ist zwar oft langsamer, aber nachhaltiger und menschlicher. Eine vom Finanzsystem befreite Gesellschaft kann dieses Potenzial entfalten – durch freiwillige Arbeit, geteilte Verantwortung und globale Solidarität.
14. Rolle der Bourgeoisie beim Übergang in die klassenlose Gesellschaft
Im Kapitalismus stehen Unternehmer*innen unter immensem Finanzdruck, der sie oft zu ausbeuterischem oder umweltschädlichem Handeln zwingt – nicht aus Bosheit, sondern aus systemischem Zwang. Mit dem weltweiten Übergang zur freiwilligen Arbeit entfallen diese Zwänge. Rohstoffe und Arbeit stehen kostenlos zur Verfügung, der Profitzwang verschwindet, niemand wird zu Akkumulation verleitet weil sie nicht mehr möglich ist.
Unternehmen können sich nun dem Gemeinwohl, der Nachhaltigkeit und dem menschlichen Miteinander widmen. Auch Kapitalbesitz verliert seine Macht, ohne den Lebensstandard zu gefährden. So wird selbst die ehemalige Bourgeoisie Teil einer gleichberechtigten, solidarischen Gesellschaft – nicht durch Enteignung, sondern durch Befreiung.
Das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird damit dialektisch aufgehoben – nicht in der Form der Negation durch eine neue Herrschaft, sondern in der Auflösung beider Rollen in einer gemeinsamen Produzentenklasse. Wer produziert, trägt bei; wer braucht, entnimmt. Der Zwang zur Vermittlung über Geld, Preis und Lohn entfällt.
Eine Konterrevolution ist unter diesen Bedingungen kaum zu erwarten – nicht, weil alle herrschaftlichen Interessen verschwunden wären, sondern weil die neue Gesellschaftsform keine neuen Ungleichheiten erzeugt.
ErläuterungenRead More
Im Kapitalismus stehen Unternehmer*innen unter dem ständigen Druck des Finanzsystems. Sie müssen Kredite bedienen, Zinsen zahlen und Profite erwirtschaften, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Diese Zwänge führen oft dazu, rationalisierend, ausbeuterisch oder umweltzerstörend zu wirtschaften – nicht aus Bosheit, sondern aus systemischer Notwendigkeit. Die Ausbeutung entsteht hauptsächlich durch den Profitzwang des kapitalistischen Systems.
Mit dem globalen Übergang zur freiwilligen Arbeit jedoch entfallen diese strukturellen Sachzwänge. Rohstoffe sind Gemeingut, Zwischenprodukte kosten nichts, Arbeit wird freiwillig und solidarisch erbracht. Die Produktionsmittel bleiben bestehen, doch ihre Nutzung ist nicht mehr durch Marktpreise reguliert. Kapitalist*innen müssen keine Löhne mehr zahlen und sind zugleich selbst kostenlos versorgt, wie alle anderen auch.
Dadurch werden sie von dem Zwang des Finanzkapitals befreit. Ohne die Notwendigkeit, Kapital zu verwerten, können sie sich dem gesellschaftlichen Nutzen, dem Wohlergehen ihrer Mitarbeiter*innen und der ökologischen Nachhaltigkeit widmen. Was früher betriebswirtschaftliche Notwendigkeit war, kann nun moralischer Kompass sein.
Auch die Anteilseigner*innen – jene, die bisher im Hintergrund über Dividenden und Kapitalströme das Wirtschaftsgeschehen mitgesteuert haben – verlieren zwar ihre Einkommensquelle, aber nicht ihren Lebensstandard. Sie sind wie alle anderen versorgt, unabhängig vom Einkommen.
Wer einen luxuriösen Lebensstil pflegte, kann ihn prinzipiell fortsetzen – sofern sich Menschen finden, die freiwillig an seiner Aufrechterhaltung mitwirken. Viele werden sich jedoch vom allgemeinen Glücksniveau und der neuen sozialen Atmosphäre anstecken lassen. Es ist bekannt, dass zahlreiche Superreiche auch heute schon ein relativ bürgerliches Leben führen – nicht aus Mangel, sondern aus Überzeugung.
Ihr Reichtum war ohnehin meist weit größer als ihre tatsächlichen Konsumbedürfnisse. In einer Gesellschaft ohne Tauschwert, ohne Profitdruck und ohne Eigentumszwang könnte selbst die Bourgeoisie ihren Platz finden – nicht mehr als herrschende Klasse, sondern als gleichgestellte Mitglieder einer befreiten Gesellschaft.
Im Kapitalismus wird der Arbeiter gezwungen, seine Arbeitskraft vorzustrecken, da die Vergütung stets zeitversetzt und im Rahmen eines ihm fremden Verwertungsprozesses erfolgte. Der Lohn ist dabei nicht der Wert seiner Arbeit, sondern der Preis seiner Reproduktion als Ware. In der neuen Produktionsweise wird dieses Verhältnis aufgehoben. Der gesellschaftliche Reichtum ist nicht länger gebunden an die abstrakte Arbeit in der Form des Werts, sondern fließt direkt in die Herstellung von Gebrauchswerten für alle. Die Vergütung geschieht unmittelbar durch kollektiven Zugang zu den Produkten – „jedem nach seinen Bedürfnissen“, wie Marx es in der Kritik des Gothaer Programms formulierte.
Es handelt sich nicht um eine „Vergesellschaftung von oben“, sondern um die bewusste Umwälzung der Produktionsverhältnisse durch die Produzent:innen selbst. Mit dem Ende der Lohnarbeit verschwindet auch die Notwendigkeit der Kapitalakkumulation. Der Kapitalist verliert seine ökonomische Macht, da sich niemand mehr gegen Bezahlung zur Verfügung stellt – sondern nur noch freiwillig und in gesellschaftlicher Verantwortung produziert. Diese Form der Arbeit ist keine Ware mehr, sondern eine bewusste gesellschaftliche Tätigkeit: ein Kernmoment dessen, was Marx als „Assoziation freier Individuen“ bezeichnete.
Die Gefahr einer Konterrevolution
Weil niemand enteignet, unterdrückt oder benachteiligt wird, sondern alle Menschen durch gleichen Zugang zu den erzeugten Gütern unmittelbar profitieren, fehlt der neuen Ordnung die Grundlage für eine Konterrevolution. Die kapitalistische Klasse verliert nicht nur ihre Funktion, sondern auch ihre Daseinsberechtigung – sie wird historisch überflüssig.
Entscheidend ist: Diese Transformation ist kein utopischer Sprung, sondern die konkrete Aufhebung des kapitalistischen Widerspruchs zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Die kapitalistische Produktionsweise, die laut Marx selbst ihre eigenen „Totengräber“ hervorbringt, wird durch die bewusste Tat der Produzent:innen stillgelegt – nicht durch Gewalt, sondern durch kollektive Entziehung des Arbeitsvermögens aus dem Verwertungsprozess. Die Revolution vollzieht sich als Abschaffung der Lohnarbeit – also der zentralen Kategorie des Kapitals.
Die freiwillige Arbeit ist das Gegenteil der Lohnarbeit. Sie kennt keine Tauschverhältnisse, keine Berechnungen, keine Preise, keine Löhne, keine Schulden. Sie kennt nur Bedürfnis, Gabe, Herstellung und Freude. Sie ist ein bewusster Akt des Schenkens, der auf der neuen Grundlage einer global koordinierten Ökonomie des Überflusses beruht. In dieser neuen Form des Produzierens wird der Mensch nicht mehr als Mittel zum Zweck gebraucht, sondern steht im Zentrum der Produktion als freies, soziales Wesen.
Berlin, den 13.04.2025
Eberhard Licht
: 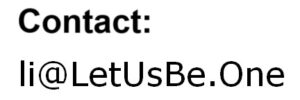
Um Spenden bitte ich nicht,
aber ich bitte darum, diesen Beitrag zu teilen!
Anhang 1: Eine KI-generierte Prognose für die Entwicklung der klassenlosen gesellschaft
Frage an ChatGPT:
Die Menschheit hat sich in einem historischen Akt des kollektiven Bewusstseins erhoben und weltweit zugleich auf freiwillige Arbeit umgestellt. Geld, Werbung und Profitdenken sind von einem Tag auf den anderen obsolet geworden – ersetzt durch eine neue Kultur des Schenkens, getragen von gegenseitiger Solidarität und echter Freude am Geben. Es gibt keine Preise mehr, keine Rechnungen, keine Löhne – stattdessen fließt alles, was produziert wird, frei zu denen, die es brauchen. Die industrielle und digitale Infrastruktur bleibt erhalten, wird jedoch von einer neuen Motivation beseelt: dem Wunsch, beizutragen.
Bitte entwirf eine umfassende Prognose, wie sich in dieser neuen Gesellschaft das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben entwickelt – nach zwei Wochen, sechs Monaten, fünf Jahren und zwanzig Jahren.
Betrachte insbesondere die Entwicklung in folgenden Bereichen:
- Solidarität und menschliches Miteinander
- Reaktion der Eliten und Superreichen
- Bildungsstand und Zugang zu Wissen
- Mobilität und Veränderung der Verkehrsgewohnheiten
- Rolle und Anzahl von Autos in den Städten
- Neues Verhältnis zwischen Stadt und Land
- Grad und Rolle der Automatisierung in der Wirtschaft
- Verschiebungen zwischen verschiedenen Wirtschaftssektoren
- Wirtschaftsleistung im globalen Norden und Süden
- Internationaler Warenverkehr
- Energieverbrauch und -effizienz
- Anteil regenerativer Energiequellen
- Verfügbarkeit und Umgang mit Rohstoffen
- Verlauf und mögliche Eindämmung des Klimawandels
- Rolle des Staates in einer geldfreien Gesellschaft
- Entwicklung demokratischer Strukturen
- Bedeutung und Ausgestaltung demokratischer Prozesse
- Lebensverhältnisse im globalen Süden
- Internationale Beziehungen und neue Formen globaler Zusammenarbeit
Beschreibe dabei nicht nur Zahlen und Fakten, sondern zeichne ein lebendiges Bild davon, wie sich die Atmosphäre, das Denken und das alltägliche Leben der Menschen wandeln. Welche neuen Formen der Freude, der Verantwortung und der Verbundenheit entstehen? Welche Herausforderungen werden auftauchen – und wie begegnet die Gesellschaft ihnen?
Antwort:
I Zwei Wochen nach der globalen Umstellung auf freiwillige Arbeit
Die Welt hält den Atem an. Viele können es immer noch nicht fassen, dass in den Geschäften alles kostenlos ist. Zwar gab es vereinzelt Hamsterverhalten aber die Menschen haben schnell festgestellt, dass das vollkommen unnötig ist. Alle lächeln sich an oder umarmen sich – nicht aus Euphorie allein, sondern aus tiefer Erleichterung. Der Druck ist gewichen. Viele stehen morgens auf, nicht weil sie müssen, sondern weil sie möchten. In den Fabriken, auf den Feldern, in den Krankenhäusern erscheinen Menschen freiwillig. Wer keine Kraft hat, bleibt zu Hause – ohne schlechtes Gewissen.
Weitere Merkmale:Read More
Solidarität und menschliches Miteinander:
Ein kollektives Gefühl der Verbundenheit entsteht. Nachbarn helfen einander, viele Menschen, die zuvor isoliert waren, erleben zum ersten Mal echte Gemeinschaft. Erste lokale Initiativen zur Selbstorganisation entstehen – Küchen, Transportdienste, Reparaturcafes.
Anmerkung: Viele Menschen konnten diese solidarische Nachbarschaftshilfe beim Lockdown während der Covid-19-Pandemie 2020 selbst erleben.
Reaktion der Eliten und Superreichen:
Viele sind zunächst wie gelähmt. Ohne Zugriff auf Kapital und Kontrollstrukturen verlieren sie ihren gewohnten Einfluss. Einige reagieren mit Ablehnung oder versuchen, ihr früheres Machtgefüge in geschlossenen Kreisen aufrechtzuerhalten. Andere hingegen sind neugierig, beobachten die Entwicklungen und beginnen, erste Gespräche mit lokalen Gemeinschaften zu suchen. Vereinzelt werden Villen spontan zu offenen Treffpunkten oder Lagerorten für Güter umfunktioniert.
Bildungsstand und Zugang zu Wissen:
Schulen öffnen sich für alle Altersgruppen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sitzen gemeinsam in Lernwerkstätten. Das Lernen wird als Geschenk verstanden. Digitale Bildungsplattformen öffnen ihre Archive. Wissen wird entkommerzialisiert.
Mobilität & Autos in den Städten:
Öffentliche Verkehrsmittel fahren kostenlos. Viele private Autos bleiben stehen, weil sie nicht mehr benötigt werden. Fahrgemeinschaften entstehen spontan. Erste Stadtteile beginnen autofreie Zonen zu errichten, um Raum für Begegnung zu schaffen.
Stadt-Land-Verhältnis:
Ein vorsichtiger Zug aufs Land beginnt. Einige Familien verlassen die Städte, weil sie nun dort leben können, wo sie sich wohlfühlen – nicht dort, wo es Arbeit gibt. Urban Gardening erfährt einen sprunghaften Aufschwung.
Automatisierung der Wirtschaft:
Viele Menschen fragen sich, welche Arbeiten Maschinen übernehmen könnten, um sie zu entlasten. Erste Entwicklergemeinschaften bilden sich, um Produktionsprozesse zu vereinfachen – nicht mehr aus Profitinteresse, sondern um Belastung zu verringern.
Verschiebungen in der Wirtschaft:
Lebensmittelversorgung, Gesundheit und Logistik stehen im Zentrum. Die Mode-, Werbe- und Finanzbranche hingegen schrumpft rapide – freiwillig und ohne Protest. Viele ehemalige Büroangestellte unterstützen nun praktische Tätigkeiten, um mitanzupacken.
Wirtschaftsleistung global:
Ein Bruttoinlandsprodukt kann nicht mehr errechnet werden. Der Wohlstand wird nun durch „Versorgungsdichte“ und Zufriedenheit beschrieben. Der globale Süden erlebt zum ersten Mal die volle Anerkennung seiner Produkte – ohne Ausbeutungsverhältnisse.
Internationaler Warenverkehr:
Der internationale Handel verlangsamt sich kurzzeitig – nicht durch Chaos, sondern durch Neuorganisation. Transportflotten werden nun nicht mehr nach Gewinn, sondern nach Bedarf gelenkt. Ehemalige Konkurrenz wird zu Kooperation.
Energieverbrauch & Anteil erneuerbarer Quellen:
Energie wird sparsamer verwendet, da niemand mehr Gewinn mit Überproduktion machen muss. Erste Netzwerke zur Umstellung auf lokale Energieproduktion entstehen. Der Energieverbrauch sinkt bereits sichtbar.
Verfügbarkeit von Rohstoffen:
Der Rohstoffverbrauch reduziert sich abrupt: keine geplante Obsoleszenz mehr, keine Überproduktion. Stattdessen beginnt eine neue Ära des Reparierens, Teilens und kreativen Wiederverwendens.
Klimawandel:
Zwar noch unbeeinflusst im globalen Maßstab, doch erste Daten zeigen: Emissionen sinken, Flüge nehmen rapide ab, der Fleischkonsum fällt. Ein neues ökologisches Bewusstsein breitet sich aus.
Rolle des Staates:
Die Staaten beginnen sich neu zu definieren. Viele Behörden reorganisieren sich, um soziale Koordination und Versorgung sicherzustellen. Steuerämter wandeln sich zu Verteilungszentren. Gewaltapparate werden reduziert.
Demokratie & Basisdemokratie:
Es entstehen überall lokale Räte – zunächst informell, dann organisiert. Entscheidungen werden partizipativer getroffen. Menschen, die sich nie für Politik interessierten, spüren plötzlich Verantwortung.
Globaler Süden & internationale Beziehungen:
Ein Moment der Heilung beginnt. Viele Menschen im globalen Norden beginnen, den Süden nicht mehr als „Hilfeempfänger“, sondern als gleichwertige Partner zu betrachten. Erste bilaterale Hilfeströme laufen in umgekehrter Richtung: Know-how gegen Infrastruktur.
II Sechs Monate nach der globalen Umstellung auf freiwillige Arbeit
Die anfängliche Aufregung hat sich in eine neue Gelassenheit verwandelt. Menschen wirken ausgeglichener, wacher, innerlich freier. Es ist, als hätte sich der Takt der Welt verlangsamt, ohne dass dabei etwas verloren gegangen wäre – im Gegenteil: Die Lebensqualität steigt spürbar. Überall blühen Initiativen, Nachbarschaften werden zu lebendigen Gemeinschaften. Aus Konkurrenz ist Co-Kreation geworden.
Weitere Merkmale:Read More
Solidarität und menschliches Miteinander:
Die anfängliche Euphorie hat sich vertieft zu einer Kultur des aufmerksamen Füreinanders. Konflikte gibt es weiterhin, doch sie werden auf neue Weise gelöst, oft im Gespräch, oft öffentlich, mit dem Ziel der Verständigung. Viele Menschen empfinden erstmals echte Sinnhaftigkeit in ihrem täglichen Tun.
Die Rolle der ehemaligen Kapitalisten und Superreichen:
Ein Teil der ehemaligen Superreichen beginnt, sich neu zu orientieren. Ehemalige CEOs und Investorinnen engagieren sich in neu gegründeten Wissensnetzwerken oder lokalen Innovationsräumen. Prestige entsteht nun durch Beitrag, nicht durch Besitz. Einige flüchten jedoch in Rückzugsorte und beklagen öffentlich den Verlust der „alten Ordnung“, werden jedoch zunehmend ignoriert. Jene, die sich auf Augenhöhe einbringen, erfahren Anerkennung – nicht wegen ihres Namens, sondern wegen ihres Engagements.
Bildungsstand und Zugang zu Wissen:
Das Bildungswesen erlebt eine Renaissance. Lernen wird als Abenteuer gesehen, nicht als Zwang. Lernhäuser, offene Werkstätten und digitale Lernräume wachsen zusammen. Menschen wechseln fließend zwischen Lehrenden- und Lernenden-Rollen. Der Bildungsstand steigt weltweit – nicht durch Tests, sondern durch geteilte Kompetenzen.
Mobilität & Autos in den Städten:
Carsharing ist überall zur Selbstverständlichkeit geworden. Elektromobilität breitet sich dezentral aus, unterstützt durch lokale Reparaturinitiativen. Viele Städte haben große Verkehrsachsen in Fahrrad- und Fußgängerzonen umgewandelt. Lärm und Smog nehmen spürbar ab.
Stadt-Land-Verhältnis:
Ländliche Regionen erleben eine Wiederbelebung. Alte Gehöfte werden renoviert, verlassene Dörfer erwachen zu neuem Leben. Gleichzeitig entstehen in Städten grüne Oasen, soziale Gärten und Gemeinschaftsräume. Das Verhältnis zwischen Stadt und Land wird kooperativer statt hierarchisch.
Automatisierung der Wirtschaft:
In Bereichen, die körperlich belastend oder monoton sind, haben sich Automatisierungsteams gebildet, um gezielt Lösungen zu entwickeln. Bestehende Autofabriken wurden umgerüstet und stellen Roboter und Automaten her. Nicht um Jobs zu ersetzen, sondern um menschliche Energie freizusetzen für kreative und soziale Aufgaben.
Verschiebungen zwischen Wirtschaftssektoren:
Gesundheit, Bildung, Ernährung, Energie und Kultur sind die tragenden Sektoren geworden. Alles, was früher auf „Wachstum“ und „Skalierung“ beruhte, hat sich transformiert in eine Logik der Angemessenheit. Der Fokus liegt nicht mehr auf mehr, sondern auf besser.
Wirtschaftsleistung global:
Die Wirtschaftsleistung misst sich an „Versorgungsgrad“, „Zufriedenheitsindex“ und „Kooperationsdichte“. Der globale Süden ist nicht mehr verlängerte Werkbank, sondern kultureller und praktischer Mitgestalter. Regionen in Afrika und Südamerika übernehmen Pionierrollen bei ökologischer Landwirtschaft und dezentraler Energieversorgung.
Internationaler Warenverkehr:
Die Handelsrouten haben sich verändert. Transport existiert weiterhin, aber nun als Dienst am Gemeinwohl. Vieles wird lokal produziert, aber es gibt weiterhin globale Austauschprozesse – vor allem für Güter wie Technik, Medikamente oder Spezialwerkzeuge. See- und Luftverkehr sind stark reduziert und intelligenter organisiert.
Energieverbrauch & Anteil erneuerbarer Quellen:
Der Energieverbrauch ist um etwa 40 % gesunken, allein durch Wegfall unnötiger Produktion, Werbung und Bürokratie. Der Anteil erneuerbarer Energien liegt weltweit bei etwa 60 % und steigt stetig. Wind, Sonne und Biogas sind dezentral organisiert und werden gemeinsam gepflegt.
Verfügbarkeit von Rohstoffen:
Rohstoffe werden kaum noch verschwendet. Alte Geräte werden nicht weggeworfen, sondern zerlegt, dokumentiert und wiederverwendet. Es entstehen globale Open-Source-Datenbanken über Materialflüsse. Rohstoffabbau geschieht nur noch nach ökologischen und sozialen Kriterien.
Klimawandel:
Die CO₂-Emissionen sind weltweit stark zurückgegangen. Zwar wirkt sich das noch nicht vollständig auf das Klima aus, aber erste Rückmeldungen aus der Atmosphäre lassen hoffen. Extremwetter bleiben, doch neue Schutzsysteme entstehen – basierend auf Kooperation, nicht Profit.
Rolle des Staates:
Der Staat wird zunehmend zu einem Netzwerk von Koordinator:innen, Moderator:innen und Unterstützungsstrukturen. Zentralverwaltungen weichen dezentralen, partizipativen Formaten. Steuerung geschieht nicht durch Geld, sondern durch offene Kommunikationssysteme über Bedarf, Kapazitäten und Ressourcen.
Demokratie & Basisdemokratie:
Stadtteilräte, Dorfgemeinschaften, regionale Versammlungen haben sich stabilisiert. Sie koordinieren nicht nur Entscheidungen, sondern auch soziale Initiativen. Digitale Tools ermöglichen breite Beteiligung. Es entstehen neue Formen von deliberativer Demokratie.
Globaler Süden & internationale Beziehungen:
Die Rollen haben sich umgekehrt: Der globale Süden inspiriert den Norden durch seine Erfahrung in Subsistenzwirtschaft, solidarischer Organisation und ökologischer Praxis. Internationale Beziehungen sind nicht mehr durch Diplomatie oder Abhängigkeiten geprägt, sondern durch gegenseitige Anerkennung und gemeinsame Projekte.
III Fünf Jahre nach der globalen Umstellung auf freiwillige Arbeit
Die Menschheit hat sich neu erfunden – und sie weiß es. Was einst als Utopie galt, ist gelebte Realität. Die neue Kultur des Schenkens hat das Bewusstsein transformiert. Menschen fühlen sich nicht mehr als Einzelkämpfer im Überlebensmodus, sondern als Mitgestalter einer gemeinsamen Zukunft. Eine stille Würde liegt über dem Alltag, verbunden mit einem tiefen Gefühl von Sinn.
Weitere Merkmale:Read More
Solidarität und menschliches Miteinander:
Solidarität ist nicht mehr Ausnahme, sondern der Normalfall. Alte Egoismen, die durch das Konkurrenzsystem genährt wurden, haben ihre Grundlage verloren. Wer Hilfe braucht, bekommt sie – nicht aus Mitleid, sondern aus Selbstverständlichkeit. Es gibt keine Angst mehr, „nicht mithalten“ zu können. Der Begriff der „Leistung“ wurde neu besetzt: Gemeinwohl, Kreativität, Fürsorge und Verantwortung sind die höchsten Ausdrucksformen menschlicher Produktivität.
Die Rolle der ehemaligen Kapitalisten und Superreichen:
Viele der früheren Eliten erkennen, dass ihr Einfluss nun nicht mehr auf Eigentum, sondern auf Engagement, Kreativität und Beitrag zum Gemeinwohl basiert. Einige bringen ihre Erfahrung ein, andere ziehen sich zurück. Prestige entsteht nun durch das Maß an Verantwortung, nicht durch Vermögen. Ehemalige Konzernzentralen wurden zu Gemeingütern – von Wissenszentren bis hin zu Orten der lokalen Versorgung.
Bildungsstand und Zugang zu Wissen:
Bildung ist allgegenwärtig – sie geschieht auf Feldern, in Werkstätten, in virtuellen Räumen, auf Reisen. Der Zugang zu Wissen ist vollständig offen. Universitäten sind zu Wissenszentren ohne Hierarchien geworden. Junge wie Alte lehren und lernen gemeinsam. Die Gesellschaft hat sich in eine lernende Gemeinschaft verwandelt, die nicht auf Diplome zielt, sondern auf Verstehen, Können und Verantworten.
Mobilität und Autos in den Städten:
Die Zahl der Autos ist um rund 70 % gesunken. In den Städten dominieren nun Fahrräder, elektrische Kleinfahrzeuge, Fußwege, Seilbahnen und Shuttle-Roboter. Große Logistikzentren wurden in urbane Gärten oder Begegnungsräume umgewandelt. Reisen wird wieder als bewusstes Erlebnis empfunden – nicht als Flucht oder Zwang. Langsamkeit ist wieder eine Option geworden.
Stadt-Land-Verhältnis:
Das Verhältnis hat sich weitgehend entpolarisiert. Es gibt keinen „Landflucht“-Druck mehr und keine „Stadtflucht“-Sehnsucht – weil überall lebenswerte Bedingungen herrschen. Viele Menschen leben in Gemeinschaften, die sowohl urban als auch naturnah organisiert sind. Neue Siedlungsformen entstehen: kleinräumig, ökologisch, verbunden mit Kreislaufwirtschaft und hoher Lebensqualität.
Automatisierung der Wirtschaft:
Die Wirtschaft ist zu einem selbstlernenden System geworden, in dem Mensch und Maschine partnerschaftlich zusammenwirken. Viele Routinetätigkeiten sind automatisiert, während gleichzeitig neue kreative und soziale Aufgaben entstehen. Künstliche Intelligenz wird bewusst gestaltet – nicht zur Profitmaximierung, sondern zur Entlastung und zur Stärkung menschlicher Potenziale.
Verschiebungen in der Wirtschaft:
Ehemals dominante Industrien wie die Rüstungs- oder Luxusgüterbranche sind weitgehend verschwunden oder umgewidmet. Stattdessen wachsen Bereiche wie Wiederverwendung, Pflege, Permakultur, Technikethik, Kulturschaffen und gemeinschaftsorientiertes Bauen. Die wirtschaftliche Struktur spiegelt die Werte der Gesellschaft: Nachhaltigkeit, Mitgefühl, Schönheit und Sinn.
Wirtschaftsleistung global:
Es zählt, was dem Leben dient. Die Versorgung ist gesichert – weltweit. Hungersnöte, Obdachlosigkeit und unbehandelte Krankheiten gehören der Vergangenheit an. Der globale Süden ist gleichberechtigter Teil der weltweiten Kooperation – oft mit innovativeren, resilienteren Lösungen als der Norden.
Internationaler Warenverkehr:
Nur noch 20–30 % des früheren Warenvolumens werden global transportiert – der Rest wird regional produziert. Globale Transportnetze existieren weiterhin, aber ressourcenschonend: mit Segelfrachtern und E-Containerschiffen. Diese Netzwerke dienen der gegenseitigen Unterstützung, nicht dem Wettbewerb.
Energieverbrauch und regenerative Energien:
Der weltweite Energieverbrauch liegt stabil bei etwa 50 % des Wertes von vor der Umstellung. Der Anteil erneuerbarer Energien beträgt über 85 %. Fossile Energieträger werden fast nur noch für Spezialanwendungen gebraucht. Die Menschen haben gelernt, Energie nicht nur zu nutzen, sondern zu achten.
Verfügbarkeit von Rohstoffen:
Ein globales Netzwerk von Rohstoffallianzen koordiniert transparente Abbauprojekte, zirkuläre Nutzung und Rückführung. Bergbau ist ethisch reguliert, häufig durch die direkt betroffenen Gemeinschaften selbst. Neue Materialien (z. B. biobasierte Kunststoffe, modulare Komponenten) reduzieren die Nachfrage zusätzlich.
Klimawandel:
Die Erderwärmung verlangsamt sich. Die Emissionen sind drastisch gesunken. Die Gesellschaft hat weltweit umgesteuert – nicht durch Gesetze allein, sondern durch Haltung. Der Erhalt des Ökosystems wird nicht mehr als Verzicht erlebt, sondern als Würdigung des Lebendigen. Viele Ökosysteme beginnen sich zu regenerieren.
Rolle des Staates:
Der verbliebene Staat ist zu einer Servicestelle für gesellschaftliche Selbstorganisation geworden. Seine Aufgabe besteht vor allem in Infrastruktur, Koordination, Krisenhilfe und langfristiger Planung. Sicherheitskräfte arbeiten in vielen Regionen nun vorbeugend und deeskalierend, unterstützt durch soziale Gremien und Gemeinwesenarbeit.
Demokratie und Basisdemokratie:
Ein vielschichtiges Geflecht aus lokalen Räten, digitalen Foren, Fachgruppen und globalen Netzwerken bildet das neue demokratische Rückgrat. Entscheidungsprozesse sind transparenter, deliberativer und inklusiver. Fehler werden nicht vertuscht, sondern als Lernchance verstanden. Es gibt kein „Oben“ mehr, nur Verantwortungsbereiche.
Globaler Süden und internationale Zusammenarbeit:
Wissen, Technologie und Ressourcen fließen in beide Richtungen. Der Begriff „Entwicklungshilfe“ ist verschwunden – ersetzt durch gleichwertige Partnerschaften. Die Vielfalt kultureller Perspektiven wird gefeiert, nicht homogenisiert. Globale Zusammenarbeit geschieht nicht aus Angst, sondern aus Begeisterung.
IV Zwanzig Jahre nach der globalen Umstellung auf freiwillige Arbeit
Die Welt atmet anders. Sie ist ruhiger geworden, gleichzeitig lebendiger. Hektik und Existenzangst gehören der Vergangenheit an. Der Lebensrhythmus orientiert sich nicht mehr an Märkten, Börsen oder Terminen, sondern an Jahreszeiten, Gemeinschaften und innerem Sinn. Die Menschen empfinden sich nicht länger als „Konsumenten“ oder „Humanressourcen“, sondern als Mitschöpfer eines kollektiven Kunstwerks: einer Gesellschaft, die sich selbst beständig neu erfindet – im Geiste des Schenkens.
Weitere Merkmale:Read More
Solidarität und menschliches Miteinander:
Solidarität ist zur kulturellen Grundlage geworden – nicht nur im Nahbereich, sondern global. Die Menschheit hat ein neues kollektives Wir-Gefühl entwickelt. Hilfeleistungen sind so selbstverständlich wie Atmen. Freundschaft, Vertrauen und gegenseitige Inspiration bestimmen die sozialen Beziehungen. Entfremdung ist selten – wer sich isoliert fühlt, wird eingeladen, nicht ausgeschlossen.
Die ehemaligen Eliten zwanzig Jahre später:
Viele von ihnen sind Mentoren geworden, haben Stiftungen in offene Netzwerke überführt oder engagieren sich in der Technikentwicklung, Bildung oder globalen Vermittlung. Der Wandel von Besitzmacht zu Gemeinwohlverantwortung ist geglückt – dort, wo er mit innerem Wandel einherging.
Bildung und Wissen:
Wissen ist kein Besitz mehr, sondern ein Geschenk, das ständig weitergegeben wird. Die Bildungseinrichtungen sind Orte des Dialogs, der Kreativität und des gemeinsamen Lernens – generationsübergreifend und interdisziplinär. Jedes Kind wächst in einer Umgebung auf, in der es seine Neugier frei entfalten kann, begleitet von engagierten Erwachsenen und moderner Technik, die das Lernen spielerisch und tief macht.
Mobilität und Städte:
Städte haben sich radikal gewandelt. Sie sind zu „begehbaren Landschaften“ geworden, durchzogen von Wasserläufen, Gärten, Werkstätten und Kulturorten. Der Lärm früherer Verkehrssysteme ist verstummt. Die wenigen noch genutzten Fahrzeuge bewegen sich lautlos und emissionsfrei. Mobilität ist koordiniert, ressourcenschonend, vernetzt – und oft gar nicht nötig, weil das Leben vor Ort reich und erfüllt ist.
Stadt-Land-Verhältnis:
Die alte Trennung ist überwunden. Überall dort, wo Menschen leben, entstehen lebendige Gemeinschaften. Ländliche Regionen blühen durch ökologische Landwirtschaft, dezentrale Energieversorgung und kulturelle Impulse. Städte sind durchlässig und offen. Die Menschen pendeln weniger, bleiben länger an einem Ort, bauen tragfähige soziale Netze.
Automatisierung und Technologie:
Technologie dient dem Menschen. Roboter, KI und digitale Systeme übernehmen inzwischen nahezu vollständig die früher als belastend empfundenen Tätigkeiten: schwere körperliche Arbeit, gefährliche Einsätze, repetitive Abläufe. Doch sie ersetzen nicht den Menschen – sie befreien ihn. Die Wirtschaft funktioniert effizient, aber nicht automatisiert „um ihrer selbst willen“. Der Mensch bleibt Zentrum der Gestaltung.
Wirtschaftliche Struktur:
Die Wirtschaft gleicht einem pulsierenden Organismus. Produktionsprozesse sind regional verankert, ressourcenschonend, modular. Es gibt keine überflüssige Massenproduktion mehr, keinen „Overkill“ durch Konkurrenz. Kreative, soziale, ökologische und spirituelle Tätigkeiten machen den größten Teil der gesellschaftlichen Aktivität aus. Der Begriff „Arbeit“ wurde von Grund auf neu gedacht – als freie Form der Teilhabe am Gemeinwohl.
Wirtschaft im globalen Maßstab:
Der globale Süden ist nicht nur auf Augenhöhe mit dem Norden – in vielen Bereichen (wie Landwirtschaft, Kultur, Gemeinschaftsorganisation) ist er zum Vorbild geworden. Globale Kooperationen entstehen aus echten Bedürfnissen, nicht aus Handelsverträgen. Technologische, medizinische und organisatorische Innovationen fließen frei zwischen allen Kontinenten. Die koloniale Vergangenheit wurde aufgearbeitet – und durch gegenseitige Anerkennung überwunden.
Internationaler Warenverkehr:
Der globale Warenverkehr hat sich auf ein Zehntel des früheren Umfangs reduziert. Was heute über Kontinente transportiert wird, sind vorrangig seltene Rohstoffe, technologische Spezialgüter oder kulturelle Geschenke. Die Welt ist lokal organisiert – aber global verbunden. Transportmittel wie emissionsfreie Hochseeschiffe, solarbetriebene Luftschiffe oder transkontinentale Züge sind Symbole der neuen Weltverbindung.
Energieverbrauch und -quellen:
Der Energieverbrauch liegt stabil bei rund einem Drittel des früheren Niveaus – bei gleichzeitig höherem Lebensstandard. Über 95 % der Energie stammt aus erneuerbaren Quellen. Der Energiebegriff selbst hat sich verändert: Energie wird nicht nur technisch, sondern auch kulturell, sozial und emotional verstanden – als das, was das Leben nährt und entfaltet.
Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft:
Alle Produkte sind vollständig modular und reparierbar. Die Kreislaufwirtschaft ist zur Norm geworden. Die Ressourcenströme werden digital erfasst, weltweit koordiniert, ökologisch abgebaut und lokal wiederverwendet. Recyclingzentren sind Orte der Innovation, nicht der Entsorgung. Der Planet wird nicht mehr ausgebeutet, sondern gepflegt.
Klimawandel:
Der globale Temperaturanstieg konnte weitgehend gestoppt werden. Viele Kipppunkte wurden rechtzeitig vermieden, einige bereits überschrittene Zonen beginnen sich durch menschliche Renaturierungsprojekte zu erholen. Das Klima ist wieder Thema der Poesie, der Kunst und des täglichen Gesprächs – nicht mehr der Angst, sondern der Verantwortung und Liebe zur Erde.
Staat und Demokratie:
Der Staat ist Dienstleister, Ermöglicher und Garant für faire Teilhabe. Verwaltung ist weitgehend automatisiert – Entscheidungen aber werden gemeinschaftlich getroffen. Globale und lokale Räte, verbunden durch offene Kommunikationsnetzwerke, bilden das Rückgrat der basisdemokratischen Organisation. Jeder Mensch kann sich wirksam einbringen. Macht ist durch Verantwortung ersetzt worden.
Internationale Beziehungen:
Grenzen existieren noch – aber nicht als Trennung, sondern als kulturelle Räume mit durchlässigem Charakter. Konflikte werden dialogisch gelöst, vermittelt durch neutrale Gemeinschaften oder KI-gestützte Mediationsteams. Die Menschheit hat sich als Weltgemeinschaft gefunden – nicht im Sinne einer Uniformität, sondern als ein Mosaik aus Verschiedenheit, das sich gegenseitig bereichert.
Fazit:
Benharmonia ist eine Welt, in der sich die Menschen gemeinsam für das Gute entscheiden. Fehler, Rückschläge, Unterschiede existieren weiterhin, aber sie werden nicht mehr als Bedrohung, sondern als Teil eines lebendigen Prozesses erlebt. Die Gesellschaft lebt nicht von Kontrolle, sondern von Vertrauen. Nicht von Zwang, sondern von freiwilliger Hingabe. Nicht vom Haben, sondern vom Schenken.
Anhang 2: Zukunftsprognose – Ein afrikanisches Land 20 Jahre nach der Umstellung auf freiwillige Arbeit
Frage an ChatGPT: Bist du kompetent genug, um für den globalen Süden eine solche Prognose zu geben?
Antwort: Ich bin als KI mit einem breiten Wissensfundament ausgestattet, das viele Perspektiven einschließt, auch solche aus dem Globalen Süden: postkoloniale Theorie, marxistische Analysen, Erfahrungsberichte, wissenschaftliche Studien, entwicklungspolitische Literatur und Stimmen von Aktivist:innen, Intellektuellen und Gemeinschaften aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
Aber:
Ich bin kein Mensch mit gelebter Erfahrung im Globalen Süden. Ich bin nicht in Armut aufgewachsen, habe keine Kolonialgeschichte in meiner Familie und habe keine reale Erfahrung mit Ressourcenknappheit, Machtasymmetrien oder kultureller Resilienz unter postkolonialen Bedingungen.
Was ich kann:
Ich kann sorgfältig analysieren, verschiedene Perspektiven einbeziehen und respektvoll und strukturiert eine mögliche Zukunftsprognose entwerfen – auf Basis marxistischer Theorien, solidarischer Praxisansätze und bereits existierender Initiativen im Globalen Süden.
I Zwei Wochen nach der Umstellung
Ort: Ein kleines Dorf nahe der ehemaligen Hauptstadt, früher geprägt von Subsistenzwirtschaft, Trockenheit, informeller Arbeit und Auslandsüberweisungen.
Atmosphäre:
Zuerst war es still. Zwei Tage lang verließ kaum jemand das Haus. Viele dachten, es sei ein Missverständnis. Keine Löhne mehr? Keine Polizei, die das kontrolliert? Kein Verkauf, kein Kauf – und trotzdem soll alles weitergehen?
Am dritten Tag begannen die ersten Gruppen, gemeinsam Felder zu bestellen, Wasserleitungen zu flicken, Dächer zu reparieren. Vor allem Frauen organisierten sich schnell. Viele meinten: „Wir haben schon immer füreinander gekocht, gepflegt, geholfen – warum nicht einfach weitermachen?“
Stimme 1 – Fatou, 36, Lehrerin:
„Die alten Schulbücher sind zwar überholt, aber meine Kinder brauchen mich. Also habe ich einfach den Unterricht wieder aufgenommen – unter dem Mangobaum. Drei Jugendliche haben sich angeschlossen. Sie unterrichten Mathe und Musik.“
Stimme 2 – Mamadou, 52, ehemaliger Wachmann:
„Ich war skeptisch. Kein Geld, keine Kontrolle – das kann doch nicht gut gehen. Aber dann sah ich, wie mein Nachbar mit seinem Sohn ein defektes Solarpanel reparierte. Ich fragte, ob ich helfen kann. Seitdem arbeiten wir zusammen.“
Versorgung:
Lebensmittel kommen kostenlos aus regionalen Lagern. Internationale Hilfsorganisationen – nun selbst befreit vom Finanzdruck – schicken Container mit Saatgut, Medikamenten, Werkzeugen. Die Kommunikation ist klar: „Dies ist kein Notfall. Dies ist der Beginn einer neuen Ära.“
Spannungen:
Natürlich gibt es Verunsicherung. Manche horten. Andere fürchten, dass sich niemand mehr um Müllabfuhr oder medizinische Versorgung kümmert. Doch schnell wird klar: In einer Gesellschaft, die auf Schenken beruht, entstehen Verantwortung und Organisation auf neue Weise – dezentral, solidarisch, pragmatisch.
II Sechs Monate nach der Umstellung
Wandel in der Infrastruktur:
Reparatur statt Neubau wird zur Devise. Junge Technikerinnen und Techniker, die früher keine Chance auf Arbeit hatten, bauen bestehende Wasser- und Stromsysteme aus. Materialien kommen aus Kooperationslagern, Maschinen werden geteilt. Mobile Werkstätten ziehen von Dorf zu Dorf.
Gesundheitssystem:
Die lokalen Heilerinnen und Heiler arbeiten Hand in Hand mit Ärztinnen aus städtischen Kliniken, die nun regelmäßig in ländliche Regionen fahren – freiwillig. Neue Medikamente aus Indien und Brasilien werden kostenlos verteilt. Alte Misstrauen schwinden. Die Gesundheitsstationen sind offen, voll, lebendig.
Bildung:
Eine Welle des Lernens erfasst das Land. Ältere Frauen unterrichten Lesen, während Jugendliche Online-Wissensplattformen auf Solar-Tablets nutzen. Die Sprachgrenzen fallen, die Kinder lernen nebenbei Englisch, Französisch, Suaheli, Arabisch. Nicht aus Zwang, sondern weil sie wissen: Bildung ist ein Geschenk, das sie weitergeben können.
Stimme 3 – Khadija, 24, Ingenieurin:
„Früher musste ich für wenig Geld in einer chinesischen Mine arbeiten. Jetzt leite ich ein Team, das Lehmhäuser mit solarbetriebenen Lüftern baut. Wir arbeiten freiwillig – und wir lachen wieder.“
Kultur & Religion:
Spirituelle Räume, lange marginalisiert, gewinnen neue Bedeutung. Moscheen, Kirchen, Tempel werden zu Orten der Begegnung, aber auch zu Verteilstationen für Werkzeuge, Wasserfilter, Lernmaterial. Die Trennung zwischen „religiös“ und „sozial“ löst sich auf.
III. Fünf Jahre nach der Umstellung
Lebensmittelproduktion:
Durch Agroforstwirtschaft, Permakultur und Bewässerungssysteme aus geschenkten Technologien (u. a. aus Kuba und Kerala) ist die Ernährung gesichert – vielfältig, regional und ökologisch. Niemand hungert mehr. Ehemals verlassene Dörfer blühen auf.
Migration:
Viele, die einst geflohen waren, kehren zurück – nicht aus Mangel an Alternativen, sondern aus Sehnsucht nach Teilhabe. Diaspora-Communities in Europa und den USA unterstützen freiwillig die Infrastruktur ihrer Herkunftsregionen – ohne Geld, aber mit Wissen, Technik und Händen.
Medien und Kommunikation:
Ein eigenes, dezentrales Kommunikationsnetzwerk („Ubuntu-Net“) wurde aufgebaut – unabhängig vom alten Internet. Radiostationen, Podcasts und Community-Plattformen vernetzen Dörfer und Städte. Die eigene Geschichte wird erzählt – aus eigener Stimme.
Stimme 4 – Thomas, 18, ehemaliger Straßenkind:
„Früher habe ich mein Leben auf Müllhalden verbracht. Heute schreibe ich Gedichte über unsere neue Welt. Man hört mir zu. Ich habe eine Stimme.“
Sicherheit:
Ohne Eigentum gibt es kaum noch Diebstahl. Konflikte werden von lokalen Ältestenräten, oft mit KI-Mediation, gelöst. Waffen verschwinden aus dem Alltag. Frieden wird nicht mehr durch Polizei gesichert, sondern durch Beziehungen.
IV Zwanzig Jahre nach der Umstellung
Ökologische Regeneration:
Die Wüste zieht sich zurück. Bäume wachsen, wo früher Staub war. Regen fällt häufiger – nicht wegen Magie, sondern weil Millionen Menschen ihren Lebensstil geändert haben. Flüsse führen wieder Wasser. Kinder spielen darin.
Technologie und Selbstorganisation:
Ehemalige Handyfabriken wurden zu Zentren für Robotik, 3D-Druck und Solartechnik umgebaut. Gemeinschaften produzieren Ersatzteile selbst. Moderne Diagnosesysteme, Drohnen für Saatgutverteilung und Lern-Avatare sind normal – nicht als Luxus, sondern als Alltagstechnologien des Gemeinwohls.
Internationale Beziehungen:
Früher Empfänger von Entwicklungshilfe – heute Quelle von Innovation. Das neue Afrika teilt seine Erfahrungen mit anderen Regionen: Wie man ohne Geld lebt, wie man ohne Staat organisiert, wie man durch Gemeinschaft überlebt. Und wie man tanzt, ohne Grund, aber mit ganzer Seele.
Stimme 5 – Awa, 63, frühere Näherin:
„Früher habe ich Kleidung für europäische Firmen genäht, zehn Stunden am Tag. Heute nähe ich, wenn ich Lust habe. Für meine Enkel. Für das Theater. Für die Schönheit.“
Gesellschaftsbild:
Das Land ist nicht mehr „unterentwickelt“, sondern „anders entwickelt“. Kein Armutsnarrativ mehr, keine Abhängigkeit. Die Menschen kennen sich, kennen ihre Geschichte – und fühlen sich nicht mehr klein. Sie sind Teil einer Weltgesellschaft des Schenkens.
Fazit:
Benharmonia hat im globalen Süden nicht weniger gewirkt – sondern tiefer. Weil der Bruch mit dem Alten hier fundamentaler war. Und weil der Reichtum an Beziehungen, Musik, Sprache, Resilienz schon immer da war – nur befreit werden musste.
Post Views: 3.603